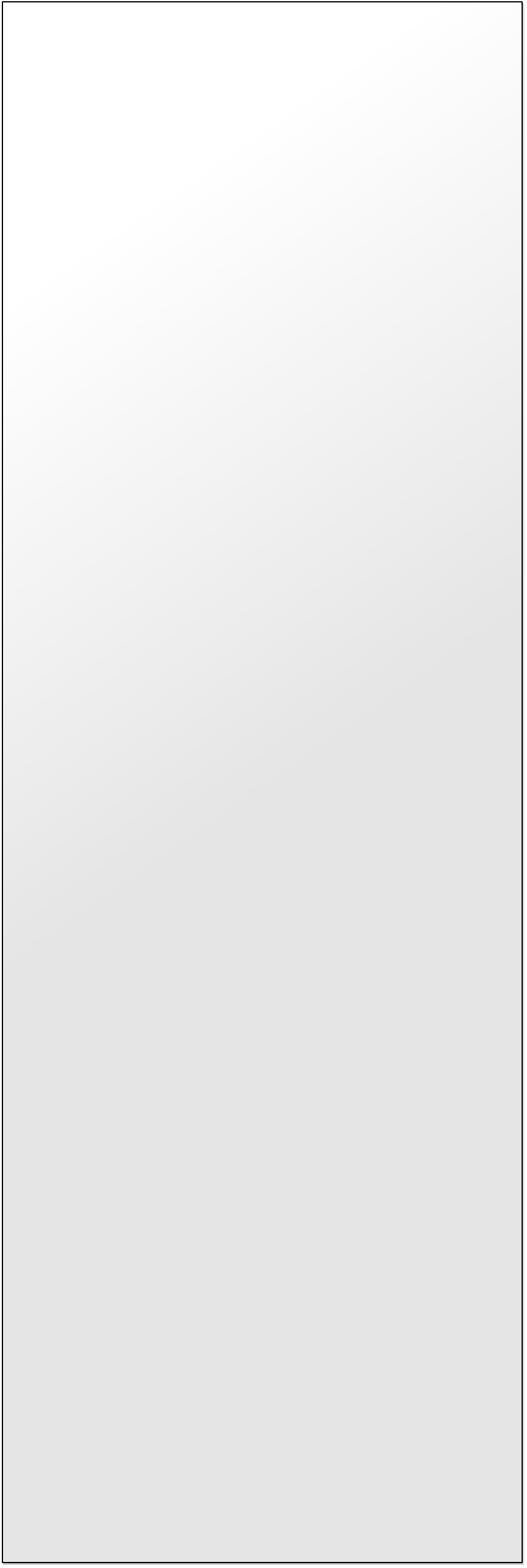
ca. 17:30
Der erste Kameraverlust hatte sich 1986 ereignet, auf der Reise zu den Waorani, den
Menschen des Waldes, besser bekannt unter dem Namen Aucas. Mein ecuadorianischer
Biologie-Kollege, M.G., hatte die Fahrt organisiert, mit ihm und Maria als Köchin waren wir
in einer insgesamt zwölfköpfigen Gruppe aufgebrochen. In der ersten Nacht waren wir im
Hotel „Cayapa“ in Lago Agrio (das offiziell Nueva Loja heisst, aber von niemandem so
genannt wird), und hier wurde mir am nächsten Morgen beim Einladen des Gepäcks in
den Bus, aus dem großen Gepäckhaufen heraus, während einer Zeitspanne von etwa einer
Minute, als beim Hinaustragen des Gepäcks keine Aufsicht war, die Kameraausrüstung
nebst Geld entwendet. Den Verlust bemerkte ich erst später, außerhalb Lago Agrios, beim
Warten auf die Fähre über den Rio Aguarico. Ich fuhr noch einmal zurück zum Hotel, als
Anhalter auf der Ladefläche eines Erdölfahrzeugs, allein, das Zeug war weg. Viel mehr
noch als der finanzielle Verlust schmerzte der Verlust der Möglichkeit, von dieser
einzigartigen Reise Aufnahmen zu machen.
Wir waren insgesamt neun Tage im Kanu auf den Flüssen; teils auf dem Rio Napo,
hinunter bis zur ecuadorianisch-peruanischen Grenze, teils auf dem Rio Yasuní, hoch zu
den Waorani. Übernachtet wurde am Flussufer, manchmal in Zelten, manchmal in den
Hütten der dortigen Bewohner, auf Bambusplanken, zwischen Hühnern und Ratten. Die
Reise war vor mehr als fünf Jahren, Ende Juni bis Anfang Juli 1986. Was ist mir geblieben
an wesentlichen Eindrücken? Beeindruckende Sonnenaufgänge über dem Rio Napo, über
dem tropischen Regenwald. Die gelben Wasser des Napo, an der Grenze zu Peru 200 bis
300 m breit. Die schwarzen Wasser des Rio Yasuní, nur etwa 50m breit, seine Ufer
überflutet, die Grenze zum Wald übergangslos. Das ältere Schweizer Ehepaar, er
schrecklich unter Diarrhoe leidend, was die Stunden im engen Kanu nicht versüßt haben
dürfte. Die Militärkontrollen im Grenzgebiet zum nicht wohlgelittenen Nachbarland Perú,
das entschlossene Nennen von Namen von ihr bekannten Militärs durch Maria, was uns die
Durchfahrt an Kontrollpunkten möglich machte. In einer Fischerhütte an einer malerischen
Lagune am Rio Yasuní, in einem ansonsten menschenleeren Gebiet, trafen wir einen
vielleicht Mittzwanziger, der mit, ich vermute kolumbianischen Dialekt sprach, der in
Europa gereist war, der angab, hier Fische zu fangen. Er war mit Vorräten, unter anderem
Kaffee und Tabak aus Kolumbien, eingedeckt. In der Nacht hörten wir an und ab das
Brummen von Propellerflugzeugen, in dieser weitabgelegenen Gegend, nur etwa zwei
Tagesreisen von den Waorani entfernt. Und ein merkwürdiges Surren, immer in der Nacht,
wie von weit entfernten Windmühlen, auch während der Übernachtung bei der Rückkehr.
Der Verdacht, dass hier in der Nähe eine Kokainproduktionsstätte war, wurde auch durch
das auffallend nervöse Verhalten des Einsiedlers bestärkt, der, als die Geräusche eines
Außenborders in der Ferne ertönten, sich in sein Boot schwang und für eine Weile
verschwand, sich aber wieder beruhigte, nachdem er festgestellt hatte, dass es sich um
eine ungefährliche Militärpatrouille gehandelt hatte. Da die Militärstation nur wenige
Bootsstunden entfernt war, musste zumindest deren Duldung der vermuteten Aktivitäten
vorliegen. Vielleicht wollte man uns deshalb die Weiterfahrt verwehren.
An dieser Hütte verspeisten wir aus der Lagune gezogene Piranhas, mehr Gräten als Fisch,
und nahmen, nicht ohne ein etwas komisches Gefühl, ein Bad neben dem Netz, in dem die
Piranhas stecken geblieben waren. An dieser Hütte brach auch der unglückselige
Schweizer durch die morschen Planken, die halbmannshoch um die Hütte herumführten,
so dass nur noch sein Kopf und ein Teil der Brust heraus sahen, über und über mit Milch
bespritzt, die er in einem Topf zur Küche hatte bringen wollen. Dass wir unser Lachen
nicht zurückhalten konnten, erfreute ihn gar nicht.
Bei den Waorani lebte ein ca. 30-40jähriger missionierender Hochlandindianer aus, ich bin
mir nicht mehr sicher, Riobamba vielleicht, der ihnen unter anderem auch den Gebrauch
einer Säge beibrachte.
Statt des Plastiktands für die Frauen, die Gu. als Gastgeschenk mitgebracht hatte, wäre
Seife von den Waorani viel lieber gesehen worden. „Jabon“ war eines der wenigen
spanischen Wörter, das sie kannten, und sie gebrauchten es stets mit der Gebärde des
Kopfwaschens. Der Stamm schien sehr friedlich; dem Europäer war allerdings das
ungenierte Betasten seiner Kleider und seines Körpers fremd. Auch der von ihnen
vehement vorgeschlagene Tausch ihrer Hängematten gegen unsere Luftmatratzen hätte
vermutlich nach dem ersten Loch mindestens den Besuchern nach uns Schwierigkeiten
bereitet. Wir wehrten mit Mühe den Tauschwunsch ab.
Der andere Stamm, eine Tagesreise weiter flussaufwärts, galt als sehr mordlustig, und
auch der Missionar wagte sich nicht dort hinauf. Aber auch bei unserem Stamm war mir,
als ich im mondlosen Dunkel auf unsere Zelte aufpasste (es war notwendig, da die
Waoranis ein signifikant anderes Verhältnis zu Eigentum als wir haben), während meine
Mitreisenden auf der anderen Seite des Dorfes bei der Missionarshütte aßen, unheimlich
zumute, als ich den monotonen, dunklen und gutturalen Singsang der Waorani in den
Hütten neben mir hörte.
Viele Informationen zu den Waorani gibt es auf der Website von Erwin (”holt den Teufel
aus der Hölle”) Patzelt, der viele Jahre vor mir an der Deutschen Schule Quito tätig war,
und den ich einmal bei einem Besuch von ihm an seiner alten Wirkstätte zu einem Trip
Richtung Reventador begleiten durfte. Auch sein Buch “Menschen im Regenwald” ist für
Interessierte sehr empfehlenswert.
Erwin ist im November 2022 98-jährig verstorben.






Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
© strapp 2023

strapp.de durchsuchen:
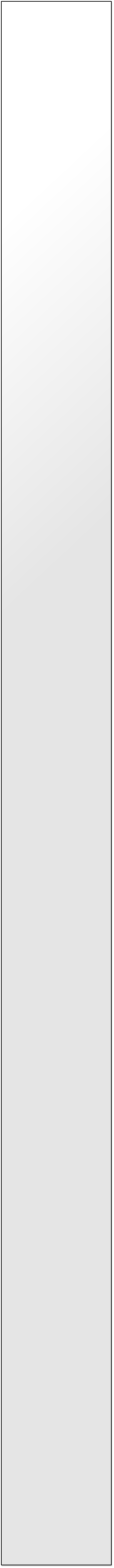
ca. 17:30
Der erste Kameraverlust hatte sich
1986 ereignet, auf der Reise zu den
Waorani, den Menschen des Waldes,
besser bekannt unter dem Namen
Aucas. Mein ecuadorianischer Biologie-
Kollege, M.G., hatte die Fahrt
organisiert, mit ihm und Maria als
Köchin waren wir in einer insgesamt
zwölfköpfigen Gruppe aufgebrochen. In
der ersten Nacht waren wir im Hotel
„Cayapa“ in Lago Agrio (das offiziell
Nueva Loja heisst, aber von
niemandem so genannt wird), und hier
wurde mir am nächsten Morgen beim
Einladen des Gepäcks in den Bus, aus
dem großen Gepäckhaufen heraus,
während einer Zeitspanne von etwa
einer Minute, als beim Hinaustragen
des Gepäcks keine Aufsicht war, die
Kameraausrüstung nebst Geld
entwendet. Den Verlust bemerkte ich
erst später, außerhalb Lago Agrios,
beim Warten auf die Fähre über den
Rio Aguarico. Ich fuhr noch einmal
zurück zum Hotel, als Anhalter auf der
Ladefläche eines Erdölfahrzeugs, allein,
das Zeug war weg. Viel mehr noch als
der finanzielle Verlust schmerzte der
Verlust der Möglichkeit, von dieser
einzigartigen Reise Aufnahmen zu
machen.
Wir waren insgesamt neun Tage im
Kanu auf den Flüssen; teils auf dem Rio
Napo, hinunter bis zur ecuadorianisch-
peruanischen Grenze, teils auf dem Rio
Yasuní, hoch zu den Waorani.
Übernachtet wurde am Flussufer,
manchmal in Zelten, manchmal in den
Hütten der dortigen Bewohner, auf
Bambusplanken, zwischen Hühnern
und Ratten. Die Reise war vor mehr als
fünf Jahren, im Juli oder August 1986.
Was ist mir geblieben an wesentlichen
Eindrücken? Beeindruckende
Sonnenaufgänge über dem Rio Napo,
über dem tropischen Regenwald. Die
gelben Wasser des Napo, an der Grenze
zu Peru 200 bis 300 m breit. Die
schwarzen Wasser des Rio Yasuní, nur
etwa 50m breit, seine Ufer überflutet,
die Grenze zum Wald übergangslos.
Das ältere Schweizer Ehepaar, er
schrecklich unter Diarrhoe leidend, was
die Stunden im engen Kanu nicht
versüßt haben dürfte. Die
Militärkontrollen im Grenzgebiet zum
nicht wohlgelittenen Nachbarland
Perú, das entschlossene Nennen von
Namen von ihr bekannten Militärs
durch Maria, was uns die Durchfahrt
an Kontrollpunkten möglich machte. In
einer Fischerhütte an einer
malerischen Lagune am Rio Yasuní, in
einem ansonsten menschenleeren
Gebiet, trafen wir einen vielleicht
Mittzwanziger, der mit, ich vermute
kolumbianischen Dialekt sprach, der in
Europa gereist war, der angab, hier
Fische zu fangen. Er war mit Vorräten,
unter anderem Kaffee und Tabak aus
Kolumbien, eingedeckt. In der Nacht
hörten wir an und ab das Brummen
von Propellerflugzeugen, in dieser
weitabgelegenen Gegend, nur etwa zwei
Tagesreisen von den Waorani entfernt.
Und ein merkwürdiges Surren, immer
in der Nacht, wie von weit entfernten
Windmühlen, auch während der
Übernachtung bei der Rückkehr. Der
Verdacht, dass hier in der Nähe eine
Kokainproduktionsstätte war, wurde
auch durch das auffallend nervöse
Verhalten des Einsiedlers bestärkt, der,
als die Geräusche eines Außenborders
in der Ferne ertönten, sich in sein Boot
schwang und für eine Weile
verschwand, sich aber wieder
beruhigte, nachdem er festgestellt
hatte, dass es sich um eine
ungefährliche Militärpatrouille
gehandelt hatte. Da die Militärstation
nur wenige Bootsstunden entfernt war,
musste zumindest deren Duldung der
vermuteten Aktivitäten vorliegen.
Vielleicht wollte man uns deshalb die
Weiterfahrt verwehren.
An dieser Hütte verspeisten wir aus der
Lagune gezogene Piranhas, mehr
Gräten als Fisch, und nahmen, nicht
ohne ein etwas komisches Gefühl, ein
Bad neben dem Netz, in dem die
Piranhas stecken geblieben waren. An
dieser Hütte brach auch der
unglückselige Schweizer durch die
morschen Planken, die halbmannshoch
um die Hütte herumführten, so dass
nur noch sein Kopf und ein Teil der
Brust heraus sahen, über und über mit
Milch bespritzt, die er in einem Topf
zur Küche hatte bringen wollen. Dass
wir unser Lachen nicht zurückhalten
konnten, erfreute ihn gar nicht.
Bei den Waorani lebte ein ca. 30-
40jähriger missionierender
Hochlandindianer aus, ich bin mir
nicht mehr sicher, Riobamba vielleicht,
der ihnen unter anderem auch den
Gebrauch einer Säge beibrachte.
Statt des Plastiktands für die Frauen,
die Gu. als Gastgeschenk mitgebracht
hatte, wäre Seife von den Waorani viel
lieber gesehen worden. „Jabon“ war
eines der wenigen spanischen Wörter,
das sie kannten, und sie gebrauchten es
stets mit der Gebärde des
Kopfwaschens. Der Stamm schien sehr
friedlich; dem Europäer war allerdings
das ungenierte Betasten seiner Kleider
und seines Körpers fremd. Auch der
von ihnen vehement vorgeschlagene
Tausch ihrer Hängematten gegen
unsere Luftmatratzen hätte vermutlich
nach dem ersten Loch mindestens den
Besuchern nach uns Schwierigkeiten
bereitet. Wir wehrten mit Mühe den
Tauschwunsch ab.
Der andere Stamm, eine Tagesreise
weiter flussaufwärts, galt als sehr
mordlustig, und auch der Missionar
wagte sich nicht dort hinauf. Aber auch
bei unserem Stamm war mir, als ich im
mondlosen Dunkel auf unsere Zelte
aufpasste (es war notwendig, da die
Waoranis ein signifikant anderes
Verhältnis zu Eigentum als wir haben),
während meine Mitreisenden auf der
anderen Seite des Dorfes bei der
Missionarshütte aßen, unheimlich
zumute, als ich den monotonen,
dunklen und gutturalen Singsang der
Waorani in den Hütten neben mir
hörte.
Viele Informationen zu den
Waorani gibt es auf der Website
von Erwin (”holt den Teufel aus
der Hölle”) Patzelt, der viele Jahre
vor mir an der Deutschen Schule
Quito tätig war, und den ich
einmal bei einem Besuch von ihm
an seiner alten Wirkstätte zu
einem Trip Richtung Reventador
begleiten durfte. Auch sein Buch
“Menschen im Regenwald” ist für
Interessierte sehr
empfehlenswert.
Erwin ist im November 2022 98-
jährig verstorben.






© strapp 2023

strapp.de durchsuchen:













