
Spiele der Erwachsenen
Johannes Geisler
Binswanger, Mathias: Sinnlose Wettbewerbe.
Warum wir immer mehr Unsinn produzieren
Herder Verlag, Freiburg 2010, 240 S., ISBN 978–3–451–
30348–7
Es sei gleich gesagt: Es handelt sich bei Binswangers Buch
nicht um eine Kapitalismuskritik, sondern um Kritik an
heutigen Formen des freien Wettbewerbs im Kapita-
lismus, dessen Magie sich in allen Bereichen zu entfalten
droht und notfalls solange gefördert wird, bis er sich
selbst auch dem Einfältigsten als dummdreister Exzess
darstellt, nämlich in Gestalt „sinnloser Wettbewerbe“!
Diese sind ein Ausdruck der immer währenden Sucht nach
Leistungssteigerung, beflügelt durch das Dogma, dass durch den Wettbewerb der
Besten oder des Besten sich tatsächlich ein Fortschritt im Hinblick auf gewünschte
Ziele ergibt.
Dahinter steckt der ungebrochene Glaube an die Selbstregulierung der Märkte durch
Wettbewerb in all seinen Facetten, dargestellt und dokumentiert durch Statistiken und
sonstige Erhebungen. Wo Wettbewerbe nicht mehr vorhanden sind – das ist heute sehr
häufig der Fall, wie der Autor nachweist – müssen künstliche Märkte oder zumindest
Wettbewerbssituationen geschaffen werden. Im Erfinden oder Erfüllen von sinnlosen
Wettbewerben waren die Menschen schon immer kreativ, legt er an manchen Bei-
spielen dar. Mag dies bei Konsumgütern noch Sinn machen und die Qualität steigern,
macht es wenig Sinn in den Bereichen der Bildung, der Wissenschaft und des
Gesundheitswesens.
Auf zwei ganzen Seiten (122 ff .) gibt er eine Übersicht über außerhalb des Marktes
künstlich inszenierte Wettbewerbe und den dadurch produzierten Unsinn, indem diese
Bereiche nach Teilnehmern, Inhalt und Resultaten untersucht werden. Dass bei der
Forschung z. B. an Universitäten im Zuge der Exzellenzinitiativen und der Jagd nach
Drittmitteln wegen der Auswahlkriterien, der Anzahl von Publikationen und zitierten
Texten immer mehr belanglose oder unseriöse (!) Publikationen – besonders für
Zeitschriften – erzeugt werden, wundert wohl niemanden mehr. Daher wurde eine neue
Institution geschaffen, das „Peer-Review-Verfahren“, um „qualitativ hoch-stehende“
Arbeiten besonders für die A-Journale auszuwählen und der möglichen geistigen
Flachheit vorzubeugen. Um diesem Verfahren zu genügen, werden die entscheidenden
Leute zitiert, was diese wiederum als gelehrter erscheinen lässt, was … (Vielleicht ist
daher auch der Groll auf Plagiatoren so verständlich!?). Binswanger konstatiert, dass
der Run auf viele Publikationen und Zitierungen letztlich zu Betrug und Fälschungen
führt. Vielfach werden auch die Lernenden an anderen Bildungs-institutionen zwecks
Ranglisten einseitig auf Bewertungen und Prüfungen bei zunehmend sinkendem Niveau
trainiert. Hauptsache, der massenhafte Output stimmt! So an Universitäten, aber auch
an Schulen, dies mit unschönen Folgen.
Wenn beispielsweise Schulen dem Wettbewerb ausgeliefert würden, werde der schöne
Schein des Rankings, so Binswanger, wichtiger als die Erfüllung des Bildungsauft rags mit
der Folge, dass der ständige Noten- und Konkurrenzdruck die Gesundheit der Schüler in
Gefahr bringe. Ein permanentes Leistungslohnsystem mit „Zuckerbrot und Peitsche“
zerstöre wichtige Fundamente für ein erfolgreiches kreatives Lernen und desavouiere
die intrinsische Motivation von Lehrern.
Wie ausdeutbar die Wettbewerbe dann auch sein können, bestätigt die bekannteste
Studie. Sie zeigt den Unsinn für den Umgang mit Ranglisten und den daraus
resultierenden – für deutsche Pädagogen vielleicht tröstlichen – Erkenntnissen am PISA-
Test-Sieger Finnland auf. Das auf diesen Wettbewerb konditionierte Land hat laut
Statistik der UNICEF Schüler, die meist im Einelternhaushalt oder Patchwork-Familien
leben, kaum gemeinsam zu Abend essen, wenig Obst zu sich nehmen, dafür aber sehr
viel Nikotin und Alkohol konsumieren, denen die Schule wie in keinem anderen Land
verhasst ist. Liegt hier die Pädagogik und Lernpsychologie falsch oder seien die
Qualitätsindikatoren unsinnig, weil sich die Qualität nicht an messbaren Indikatoren
festmachen lässt? Nebenbei sei noch erwähnt, dass im Siegerland die 95 Prozent
Abgänger mit Gymnasialabschluss, da sie nicht auf praktische Tätigkeit vorbereitet und
ohne Berufsausbildung sind, die Jugendarbeitslosigkeit (Alter 15 bis 24) auf 19 Prozent
heben.
Gefährlich wird der Wettbewerb im Gesundheitswesen, wenn durch hohe Fallpauschalen
bei geringen Behandlungs- oder Pflegekosten entweder wenige oder unnötige standard-
isierte Maßnahmen durchgeführt werden, aber kaum für notwendige, persönliche
pflegerische Dienste Zeit bleibt. Behörden, Ärzteorganisationen, Krankenkassen und
Verbraucher-organisationen organisierten künstliche Wettbewerbe, die kaum eine
messbare Qualität zuließen, unsinnige Reize erzeugten und dabei die intrinsische
Motivation der Mitarbeiter zerstörten. Als Beispiele nennt der Verf. die Fallpauschale
(Diagnosis Related Groups, DRG), die Qualitätsinitiative FMH und den Versuch des P4P
(Pay for Performance-Programm), alles wettbewerbsorientierte Messlatten, finanziell
effektiv (sofern die Entstehung einer neuen Gesundheitsbürokratie den angeblichen
Nutzen nicht aufzehrt), aber ohne Rücksicht auf das Wohl des menschlichen Objekts.
„Qualität im Gesundheitswesen lässt sich nicht messen, stehen wir doch dazu, statt so
zu tun, als ob es doch möglich wäre“, lautet sein Bekenntnis. Dieses Eingeständnis ist
nur ein Weg aus dem Desaster. Weitere Lösungsvorschläge sieht er z. B. im Aufruf, allen
Handelnden mehr zu vertrauen, die Beteiligten stärker einzubinden, mehr persönlicher
Verantwortung zu übernehmen, Geldmittel direkt zu verteilen etc.
So zieht er als Ökonom den Schluss, dass „verlogene Begriffe wie Qualitätskennzahlen
oder Qualitätsindikatoren endgültig von der Bildfläche verschwinden sollen“ (S. 218), da
Qualität grundsätzlich nicht messbar sei. Es bleibt allerdings die Frage, wie letztlich
seine Aufrufe umgesetzt werden können, wenn die Kargheit der Mittel zu mehr ökono-
mischem Handeln zwingt. Es fehlt vielleicht eine tiefer greifende Analyse der mensch-
lichen Psyche und der Grundregeln des Zusammenlebens.
Auf jeden Fall macht das Buch nachdenklich, obwohl oder gerade weil man viele Dinge
schon ahnte, aber sich noch nicht erklären konnte. Es gibt genug Anlass zum
Nachdenken, auch über das eigene Verhalten.
Quelle: „Deutsche Lehrer im Ausland“, Heft 04/11





Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome

strapp.de durchsuchen:
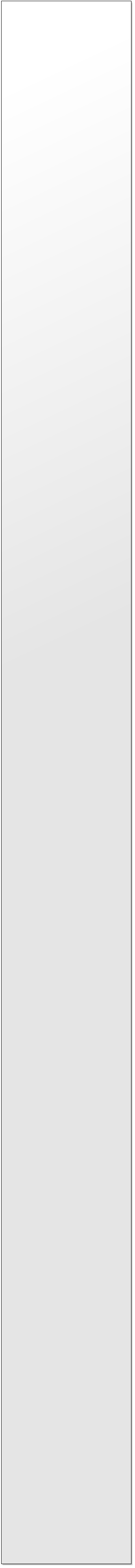
Spiele der Erwachsenen
Johannes Geisler
Binswanger, Mathias: Sinnlose Wettbewerbe.
Warum wir immer mehr Unsinn produzieren
Herder Verlag, Freiburg 2010, 240 S., ISBN
978–3–451–
30348–7
Es sei gleich gesagt: Es handelt sich bei
Binswangers Buch nicht um eine
Kapitalismuskritik, sondern um Kritik
an heutigen Formen des freien
Wettbewerbs im Kapita-lismus, dessen
Magie sich in allen Bereichen zu
entfalten droht und notfalls solange
gefördert wird, bis er sich selbst auch
dem Einfältigsten als dummdreister
Exzess darstellt, nämlich in Gestalt
„sinnloser Wettbewerbe“! Diese sind
ein Ausdruck der immer währenden
Sucht nach Leistungssteigerung,
beflügelt durch das Dogma, dass durch
den Wettbewerb der Besten oder des
Besten sich tatsächlich ein Fortschritt
im Hinblick auf gewünschte Ziele
ergibt.
Dahinter steckt der ungebrochene
Glaube an die Selbstregulierung der
Märkte durch Wettbewerb in all seinen
Facetten, dargestellt und
dokumentiert durch Statistiken und
sonstige Erhebungen. Wo Wettbewerbe
nicht mehr vorhanden sind – das ist
heute sehr häufig der Fall, wie der
Autor nachweist – müssen künstliche
Märkte oder zumindest
Wettbewerbssituationen geschaffen
werden. Im Erfinden oder Erfüllen von
sinnlosen Wettbewerben waren die
Menschen schon immer kreativ, legt er
an manchen Beispielen dar. Mag dies
bei Konsumgütern noch Sinn machen
und die Qualität steigern, macht es
wenig Sinn in den Bereichen der
Bildung, der Wissenschaft und des
Gesundheitswesens.
Auf zwei ganzen Seiten (122 ff .) gibt
er eine Übersicht über außerhalb des
Marktes künstlich inszenierte
Wettbewerbe und den dadurch
produzierten Unsinn, indem diese
Bereiche nach Teilnehmern, Inhalt und
Resultaten untersucht werden. Dass
bei der Forschung z. B. an
Universitäten im Zuge der
Exzellenzinitiativen und der Jagd nach
Drittmitteln wegen der
Auswahlkriterien, der Anzahl von
Publikationen und zitierten Texten
immer mehr belanglose oder unseriöse
(!) Publikationen – besonders für
Zeitschriften – erzeugt werden,
wundert wohl niemanden mehr. Daher
wurde eine neue Institution
geschaffen, das „Peer-Review-
Verfahren“, um „qualitativ hoch-
stehende“ Arbeiten besonders für die
A-Journale auszuwählen und der
möglichen geistigen Flachheit
vorzubeugen. Um diesem Verfahren zu
genügen, werden die entscheidenden
Leute zitiert, was diese wiederum als
gelehrter erscheinen lässt, was …
(Vielleicht ist daher auch der Groll auf
Plagiatoren so verständlich!?).
Binswanger konstatiert, dass der Run
auf viele Publikationen und Zitierungen
letztlich zu Betrug und Fälschungen
führt. Vielfach werden auch die
Lernenden an anderen Bildungs-
institutionen zwecks Ranglisten
einseitig auf Bewertungen und
Prüfungen bei zunehmend sinkendem
Niveau trainiert. Hauptsache, der
massenhafte Output stimmt! So an
Universitäten, aber auch an Schulen,
dies mit unschönen Folgen.
Wenn beispielsweise Schulen dem
Wettbewerb ausgeliefert würden, werde
der schöne Schein des Rankings, so
Binswanger, wichtiger als die Erfüllung
des Bildungsauft rags mit der Folge,
dass der ständige Noten- und
Konkurrenzdruck die Gesundheit der
Schüler in Gefahr bringe. Ein
permanentes Leistungslohnsystem mit
„Zuckerbrot und Peitsche“ zerstöre
wichtige Fundamente für ein
erfolgreiches kreatives Lernen und
desavouiere die intrinsische Motivation
von Lehrern.
Wie ausdeutbar die Wettbewerbe dann
auch sein können, bestätigt die
bekannteste Studie. Sie zeigt den
Unsinn für den Umgang mit Ranglisten
und den daraus resultierenden – für
deutsche Pädagogen vielleicht
tröstlichen – Erkenntnissen am PISA-
Test-Sieger Finnland auf. Das auf diesen
Wettbewerb konditionierte Land hat
laut Statistik der UNICEF Schüler, die
meist im Einelternhaushalt oder
Patchwork-Familien leben, kaum
gemeinsam zu Abend essen, wenig Obst
zu sich nehmen, dafür aber sehr viel
Nikotin und Alkohol konsumieren, denen
die Schule wie in keinem anderen Land
verhasst ist. Liegt hier die Pädagogik
und Lernpsychologie falsch oder seien
die Qualitätsindikatoren unsinnig, weil
sich die Qualität nicht an messbaren
Indikatoren festmachen lässt? Nebenbei
sei noch erwähnt, dass im Siegerland die
95 Prozent Abgänger mit
Gymnasialabschluss, da sie nicht auf
praktische Tätigkeit vorbereitet und
ohne Berufsausbildung sind, die
Jugendarbeitslosigkeit (Alter 15 bis 24)
auf 19 Prozent heben.
Gefährlich wird der Wettbewerb im
Gesundheitswesen, wenn durch hohe
Fallpauschalen bei geringen
Behandlungs- oder Pflegekosten
entweder wenige oder unnötige
standardisierte Maßnahmen
durchgeführt werden, aber kaum für
notwendige, persönliche pflegerische
Dienste Zeit bleibt. Behörden,
Ärzteorganisationen, Krankenkassen und
Verbraucher-organisationen
organisierten künstliche Wettbewerbe,
die kaum eine messbare Qualität
zuließen, unsinnige Reize erzeugten und
dabei die intrinsische Motivation der
Mitarbeiter zerstörten. Als Beispiele
nennt der Verf. die Fallpauschale
(Diagnosis Related Groups, DRG), die
Qualitätsinitiative FMH und den Versuch
des P4P (Pay for Performance-
Programm), alles
wettbewerbsorientierte Messlatten,
finanziell effektiv (sofern die
Entstehung einer neuen
Gesundheitsbürokratie den angeblichen
Nutzen nicht aufzehrt), aber ohne
Rücksicht auf das Wohl des
menschlichen Objekts. „Qualität im
Gesundheitswesen lässt sich nicht
messen, stehen wir doch dazu, statt so
zu tun, als ob es doch möglich wäre“,
lautet sein Bekenntnis. Dieses
Eingeständnis ist nur ein Weg aus dem
Desaster. Weitere Lösungsvorschläge
sieht er z. B. im Aufruf, allen
Handelnden mehr zu vertrauen, die
Beteiligten stärker einzubinden, mehr
persönlicher Verantwortung zu
übernehmen, Geldmittel direkt zu
verteilen etc.
So zieht er als Ökonom den Schluss, dass
„verlogene Begriffe wie
Qualitätskennzahlen oder
Qualitätsindikatoren endgültig von der
Bildfläche verschwinden sollen“ (S.
218), da Qualität grundsätzlich nicht
messbar sei. Es bleibt allerdings die
Frage, wie letztlich seine Aufrufe
umgesetzt werden können, wenn die
Kargheit der Mittel zu mehr ökono-
mischem Handeln zwingt. Es fehlt
vielleicht eine tiefer greifende Analyse
der menschlichen Psyche und der
Grundregeln des Zusammenlebens.
Auf jeden Fall macht das Buch
nachdenklich, obwohl oder gerade weil
man viele Dinge schon ahnte, aber sich
noch nicht erklären konnte. Es gibt
genug Anlass zum Nachdenken, auch
über das eigene Verhalten.
Quelle: „Deutsche Lehrer im Ausland“, Heft
04/11






strapp.de durchsuchen:



























