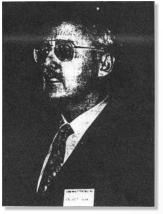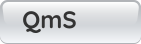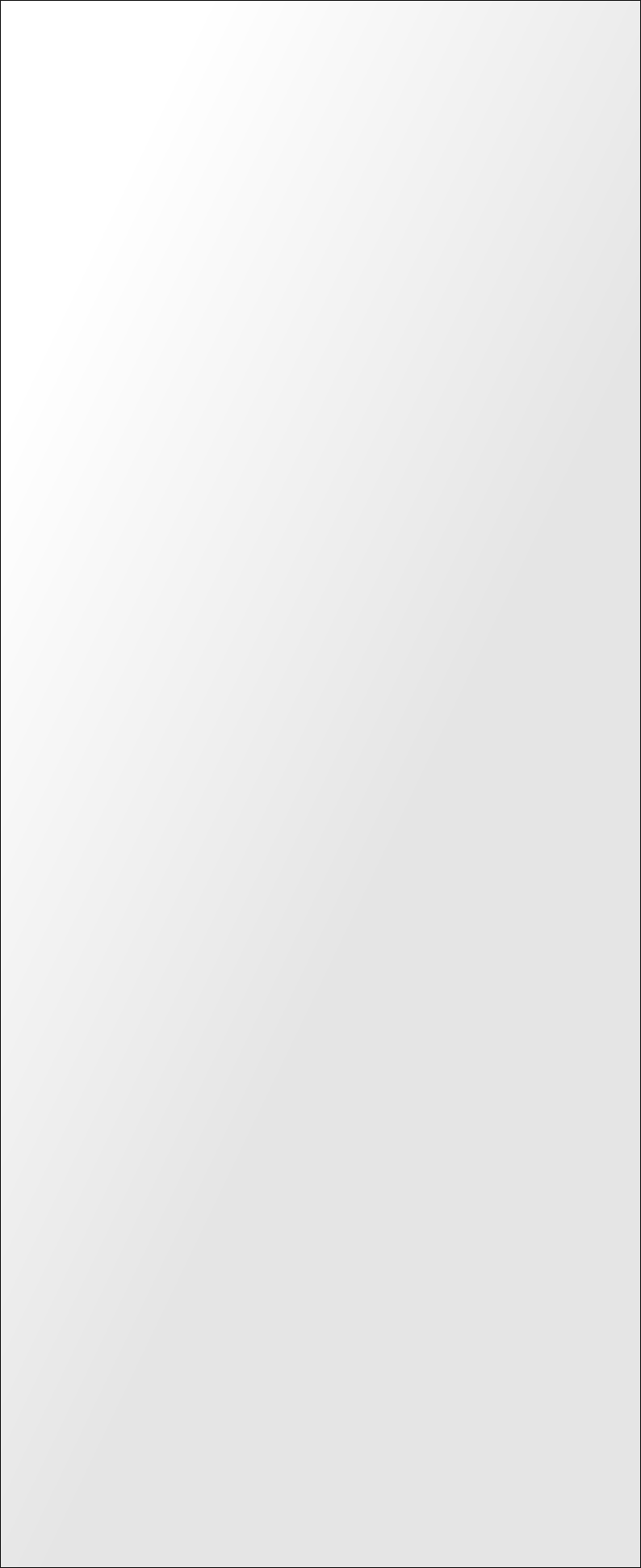




Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
Eisenhüttentag 1995
Wie leben und arbeiten wir morgen?
Vorgetragen in der Hauptsitzung des
Eisenhüttentages des VDEh am 17. November
1995.
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski,
Wissenschaftlicher Leiter. B.A.T. Freizeit-
Forschungsinstitut. Hamburg.
„Wie leben und arbeiten wir morgen?"
Diese Frage steht im Mittelpunkt des
nachfolgenden Vortrages. Er gibt einen
Ausblick über die Veränderungen in der
Arbeitswelt, auf das Leben in einer Zeit
wachsender Freizeit, einer rasch
expandierenden Freizeitindustrie und
eines immer umfassenderen Angebotes
der Medien. Die Wohlstandsgesellschaft ist
in einer Krise. Um diese zu überwinden,
stellt der Vortragende vier Forderungen:
Die materialisierte Lebenshaltung muß
überdacht werden; die Schule soll wieder
für das ganze Leben lehren; es werden
neue soziale und familienfreundliche
Leitbilder benötigt; das freiwillige Ehrenamt muß gesellschaftlich aufgewertet
werden.
Ein Nordlicht aus Hamburg soll Ihnen heimleuchten auf dem Weg in die Zukunft.
Ja, geht das eigentlich? Kann man die Elbchaussee mit dem Rheinufer
vergleichen? Beim Stichwort „Eisen" denkt ein Hanseat doch nur an „Eiserne
Lady" oder „Eiserne Ration". Ist das alles? Immerhin bin ich im oberschlesischen
Kohlerevier Beuthen geboren, meine Frau lernte ich als Schüler in Hagen-Haspe
kennen. Meine Kinder wuchsen in Siegen-Hüttental oberhalb der Birlenbacher-
Hütte auf. Und mein erstes größeres Forschungsprojekt führte ich in den siebziger
Jahren in DuisburgHamborn durch. Und im Juni d. J. hielt ich mich auch ein
paar Stunden unter Tage in Walsum auf.
Und die Folgen? Meine Tochter ist hübsch, mein Sohn gerade gewachsen und
meine Ehe hält eisern seit 28 Jahren. Ebenfalls seit 27 Jahren erforsche ich die
Lebensgewohnheiten der Deutschen im Umfeld von Arbeit, Konsum und Freizeit.
Was verändert sich schon heute? Und was kommt morgen auf uns zu?
Produktivität, Beschäftigung, neue Arbeitszeitmodelle
Stellen Sie sich einmal folgende Zukunftsperspektive vor: Die
technologische Entwicklung ermöglichte nur mehr 40 Prozent der Bevölkerung eine
bezahlte Tätigkeit am Arbeitsplatz. Diese gingen regelmäßig ihrer Alltagspflicht
nach, um die übrigen 60 Prozent der Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen zu
versorgen: „Das soziale Netz wäre nicht mehr so engmaschig wie früher, der
Lebensstandard geringer, die Lebensweise bescheidener. Arbeit wäre nur mehr für
wenige da. Die Arbeitsgesellschaft würde — unter Einbußen zwar — weiterleben
können, doch die Vollbeschäftigungsgesellschaft wäre am Ende, die
Anspruchsgesellschaft auch. Wird der Einstieg in die 35-Stunden-Woche zum
sozialen Abstieg? Weniger arbeiten und weniger verdienen gehören wohl
unmittelbar zusammen. An einer Senkung der Realeinkommen kommt kaum
einer vorbei." Dies ist keine Beschreibung von heute, war vielmehr meine Prognose
für heute - geschrieben vor über zehn Jahren im Jahre 1983.
Andererseits: Sind wir nicht schon auf dem besten Wege dorthin? Wie sähe das
Szenario eigentlich heute - aus der Sicht von 1995 - aus? Genauso! Nehmen wir ein
konkretes Beispiel: Zur Zeit werden immer mehr Autos mit immer weniger
Mitarbeitern gebaut. Und in den nächsten fünf Jahren soll die
Produktivität weiter gesteigert werden. Jeder Arbeiter soll dann pro Jahr 22
Autos (und nicht mehr nur wie heute 14) bauen. Die Produktivität nähme in fünf
Jahren um über 50 Prozent zu, obwohl im gleichen Zeitraum nur 26 Prozent
mehr Autos benötigt würden.
Daraus folgt: Die Produktivität steigt in Zukunft schneller als der Absatz und die
Nachfrage. Wenn also Autos in immer kürzerer Zeit gebaut werden, muß auch die
Arbeitszeit bei gleicher Beschäftigtenzahl anders verteilt werden. Andere
Arbeitszeitverteilung, also flexiblere Arbeitszeiten und mehr Teilzeitarbeitsplätze
oder zunehmende Massenarbeitslosigkeit heißt die Alternative.
Immer mehr Arbeitnehmer müssen also in Zukunft mit veränderten
Arbeitszeitmodellen leben: Die Beschäftigten behalten ihren Job, arbeiten immer
kürzer, verdienen aber auch weniger.
Wie würden sich die Arbeitnehmer eigentlich entscheiden, wenn sie über
längere oder kürzere Arbeitszeiten selber bestimmen könnten? Zunächst einmal
will etwa jeder dritte Arbeitnehmer möglichst „alles beim alten" belassen, ist also
mit den bisherigen Regelungen durchaus zufrieden.
Die überwiegende Mehrheit aber wünscht sich für die Zukunft neue
Arbeitszeitmodelle. So wollen zwei von fünf Arbeitnehmern auch weiterhin
genausoviel arbeiten und verdienen wie bisher, aber die Arbeitszeit „flexibler und
individueller einteilen". Sie wollen lieber Freiraum statt Freizeit. Und je jünger
die Arbeitnehmer sind, um so stärker sind ihre Individualisierungswünsche
ausgeprägt.
Immer mehr Arbeitnehmer müssen die schmerzliche Erfahrung machen: „Mehr
Freizeit ist ohne mehr Geld immer weniger wert." Damit sich ihr Niedriglohn nicht
in gravierende Einbußen an Lebensqualität verwandelt, halten sie in ihrer
Geldnot Ausschau nach neuen Einnahmequellen und Erwerbsmöglich-
keiten: Vom Zweitberuf und Teilzeitjob über Nebentätigkeiten bis hin zur
Schwarzarbeit. Der amerikanische Soziologe David Riesman wußte schon vor
weiterlesen
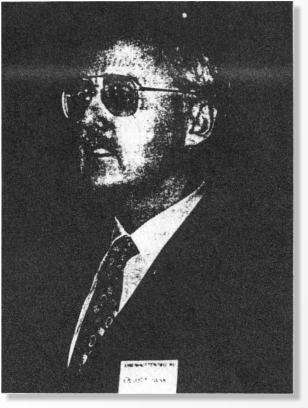

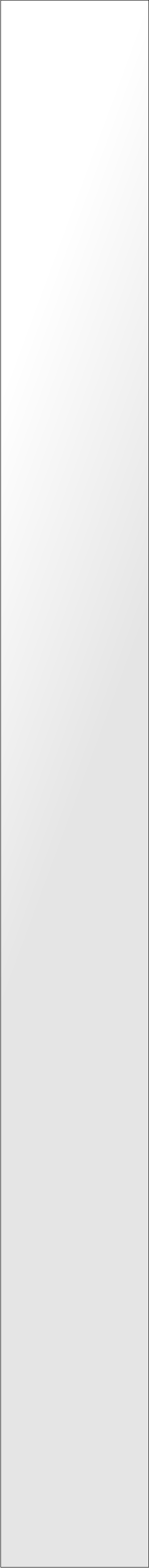




Eisenhüttentag 1995
Wie leben und
arbeiten wir
morgen?
Vorgetragen in der Hauptsitzung des
Eisenhüttentages des VDEh am 17.
November 1995.
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski,
Wissenschaftlicher Leiter. B.A.T.
Freizeit-Forschungsinstitut. Hamburg.
„Wie leben und arbeiten wir
morgen?" Diese Frage steht im
Mittelpunkt des nachfolgenden
Vortrages. Er gibt einen Ausblick
über die Veränderungen in der
Arbeitswelt, auf das Leben in einer
Zeit wachsender Freizeit, einer
rasch expandierenden
Freizeitindustrie und eines immer
umfassenderen Angebotes der
Medien. Die
Wohlstandsgesellschaft ist in einer
Krise. Um diese zu überwinden,
stellt der Vortragende vier
Forderungen: Die materialisierte
Lebenshaltung muß überdacht
werden; die Schule soll wieder für
das ganze Leben lehren; es
werden neue soziale und
familienfreundliche Leitbilder
benötigt; das freiwillige Ehrenamt
muß gesellschaftlich aufgewertet
werden.
Ein Nordlicht aus Hamburg soll Ihnen
heimleuchten auf dem Weg in die
Zukunft. Ja, geht das eigentlich? Kann
man die Elbchaussee mit dem
Rheinufer vergleichen? Beim Stichwort
„Eisen" denkt ein Hanseat doch nur an
„Eiserne Lady" oder „Eiserne Ration".
Ist das alles? Immerhin bin ich im
oberschlesischen Kohlerevier Beuthen
geboren, meine Frau lernte ich als
Schüler in Hagen-Haspe kennen. Meine
Kinder wuchsen in Siegen-Hüttental
oberhalb der Birlenbacher-Hütte auf.
Und mein erstes größeres
Forschungsprojekt führte ich in den
siebziger Jahren in DuisburgHamborn
durch. Und im Juni d. J. hielt ich mich
auch ein paar Stunden unter Tage in
Walsum auf.
Und die Folgen? Meine Tochter ist
hübsch, mein Sohn gerade gewachsen
und meine Ehe hält eisern seit 28 Jahren.
Ebenfalls seit 27 Jahren erforsche ich die
Lebensgewohnheiten der Deutschen im
Umfeld von Arbeit, Konsum und Freizeit.
Was verändert sich schon heute? Und
was kommt morgen auf uns zu?
Produktivität,
Beschäftigung, neue
Arbeitszeitmodelle
Stellen Sie sich einmal folgende
Zukunftsperspektive vor: Die
technologische Entwicklung ermöglichte
nur mehr 40 Prozent der Bevölkerung
eine bezahlte Tätigkeit am Arbeitsplatz.
Diese gingen regelmäßig ihrer
Alltagspflicht nach, um die übrigen 60
Prozent der Bevölkerung mit dem
Lebensnotwendigen zu versorgen: „Das
soziale Netz wäre nicht mehr so
engmaschig wie früher, der
Lebensstandard geringer, die
Lebensweise bescheidener. Arbeit wäre
nur mehr für wenige da. Die
Arbeitsgesellschaft würde — unter
Einbußen zwar — weiterleben können,
doch die Vollbeschäftigungsgesellschaft
wäre am Ende, die Anspruchsgesellschaft
auch. Wird der Einstieg in die 35-
Stunden-Woche zum sozialen Abstieg?
Weniger arbeiten und weniger verdienen
gehören wohl unmittelbar zusammen.
An einer Senkung der Realeinkommen
kommt kaum einer vorbei." Dies ist
keine Beschreibung von heute, war
vielmehr meine Prognose für heute -
geschrieben vor über zehn Jahren im
Jahre 1983.
Andererseits: Sind wir nicht schon auf
dem besten Wege dorthin? Wie sähe das
Szenario eigentlich heute - aus der Sicht
von 1995 - aus? Genauso! Nehmen wir ein
konkretes Beispiel: Zur Zeit werden
immer mehr Autos mit immer weniger
Mitarbeitern gebaut. Und in den
nächsten fünf Jahren soll die
Produktivität weiter gesteigert
werden. Jeder Arbeiter soll dann pro
Jahr 22 Autos (und nicht mehr nur wie
heute 14) bauen. Die Produktivität
nähme in fünf Jahren um über 50
Prozent zu, obwohl im gleichen
Zeitraum nur 26 Prozent mehr Autos
benötigt würden.
Daraus folgt: Die Produktivität steigt in
Zukunft schneller als der Absatz und die
Nachfrage. Wenn also Autos in immer
kürzerer Zeit gebaut werden, muß auch
die Arbeitszeit bei gleicher
Beschäftigtenzahl anders verteilt
werden. Andere Arbeitszeitverteilung,
also flexiblere Arbeitszeiten und mehr
Teilzeitarbeitsplätze oder zunehmende
Massenarbeitslosigkeit heißt die
Alternative.
Immer mehr Arbeitnehmer
müssen also in Zukunft mit
veränderten Arbeitszeitmodellen
leben: Die Beschäftigten behalten ihren
Job, arbeiten immer kürzer, verdienen
aber auch weniger.
Wie würden sich die Arbeitnehmer
eigentlich entscheiden, wenn sie über
längere oder kürzere Arbeitszeiten
selber bestimmen könnten? Zunächst
einmal will etwa jeder dritte
Arbeitnehmer möglichst „alles beim
alten" belassen, ist also mit den
bisherigen Regelungen durchaus
zufrieden.
Die überwiegende Mehrheit aber
wünscht sich für die Zukunft neue
Arbeitszeitmodelle. So wollen zwei von
fünf Arbeitnehmern auch weiterhin
genausoviel arbeiten und verdienen wie
bisher, aber die Arbeitszeit „flexibler und
individueller einteilen". Sie wollen lieber
Freiraum statt Freizeit. Und je
jünger die Arbeitnehmer sind, um so
stärker sind ihre
Individualisierungswünsche ausgeprägt.
Immer mehr Arbeitnehmer müssen die
schmerzliche Erfahrung machen: „Mehr
Freizeit ist ohne mehr Geld immer
weniger wert." Damit sich ihr
Niedriglohn nicht in gravierende
Einbußen an Lebensqualität
verwandelt, halten sie in ihrer Geldnot
Ausschau nach neuen
Einnahmequellen und
Erwerbsmöglich-keiten: Vom
Zweitberuf und Teilzeitjob über
Nebentätigkeiten bis hin zur
Schwarzarbeit. Der amerikanische
Soziologe David Riesman wußte schon
vor
weiterlesen