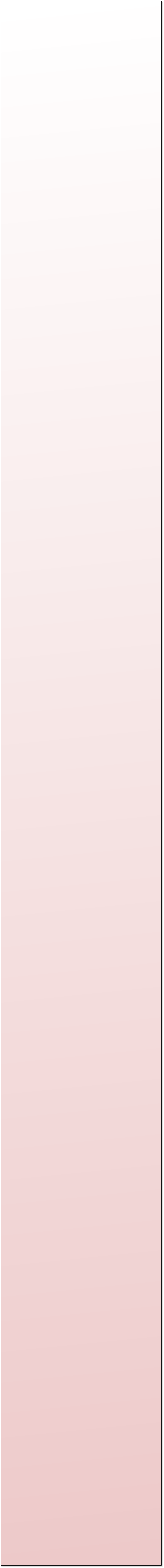




Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
DER SCANNER AN DER COUCH
"Freuds größte Entdeckung aber war, dass Worte heilen können", sagt Marianne
Leuzinger-Bohleber. "Er hat sie zu einer Zeit gemacht, in der traumatisierte Front-
soldaten noch mit Zwangsexerzieren und Elektroschocks behandelt wurden."
Dass Psychotherapie das Gehirn ebenso verändern kann wie ein Psychopharmakon,
haben Tomografie-Studien bei Depressionskranken gezeigt. In deren Gehirn ist der
Hippocampus geschrumpft und der cinguläre Cortex - der Konfliktmotor des
Gehirns, der anspringt, wenn der Mensch in Schwierigkeiten gerät - lahm gelegt.
Mit der Überwindung der Depression erholt sich das Gehirn wieder.
Aber ob die Psychoanalyse einen solchen Umbau der Neuronen in Gang setzen
kann? Der Berner Psychologe Klaus Grawe ist skeptisch: "Dafür muss das Gehirn
ungemein systematisch und zielgerichtet aktiviert werden. Eingespielte Erfahrun-
gen müssen gehemmt, neue Erfahrungen müssen immer wieder wiederholt
werden", meint der Analyse-Kritiker, der gerade ein Buch über die neuronalen
Grundlagen der Psycho-therapie geschrieben hat*. "Mit der klassischen psycho-
analytischen Haltung: ''Mal sehen, was heute vom Patienten kommt'' ist das
unvereinbar."
Die Leiterin des Freud-Instituts verweist auf andere Erfahrungen. Einige wenige
Patienten, vielleicht fünf Prozent, hätten gar keinen inneren Spielraum, in dem
solche zielgerichteten Methoden greifen könnten. Sie seien so schwer gestört, dass
sie einer gründlichen, lang andauernden Therapie bedürften.
Leuzinger-Bohleber analysierte beispielsweise eine junge Frau, die mit blutig
gekratzten Händen zur ersten Sitzung kam. Sie lebte völlig isoliert in einer dunklen
Wohnung, litt unter einem Waschzwang, schwersten Panikattacken und war wegen
ihrer Magersucht in mehreren Kliniken vergeblich mit Verhaltens- und Gesprächs-
psychotherapie behandelt worden.
Nach zwei Jahren Analyse war sie bereit, ihre Mutter nach den Umständen ihrer
ersten Lebensjahre zu fragen. Sie erfuhr, dass die Mutter versucht hatte, sie
abzutreiben. Ein Zwillingsbruder starb bei der Geburt, die Mutter versank in
Depression. Der Vater hatte den Sohn gewollt und lehnte die Tochter ab.
"Wenn wir davon ausgehen", sagt Leuzinger-Bohleber, "dass sich die neuronalen
Netze unseres emotionalen Gedächtnisses schon im Mutterleib ausbilden, dann
ergibt es einen Sinn, dass die junge Frau Nähe mit Gefühlen wie Panik, Fallen-
gelassenwerden, Todesangst zusammenbrachte."
Die junge Frau aus Leuzinger-Bohlebers Praxis zog am Ende aus ihrer schrecklichen
Wohnung aus und fand sogar einen Partner. Die Analytikerin ist überzeugt: "Wenn
wir ihr Gehirn vorher und nachher gescannt hätten, wäre die Veränderung sichtbar
geworden."
Freud hatte postuliert, Gedächtnis sei eine "Haupteigenschaft des Nervengewebes".
Dieses könne "durch einmalige Vorgänge dauerhaft verändert" werden. Tatsächlich
hat die Hirnforschung materielle Korrelate der Erinnerung gefunden: Als Eric
Kandel in den achtziger Jahren untersuchte, wie das Gedächtnis der Meeres-
schnecke Aplysia auf Berührung ihrer Kiemen reagiert, reichte schon eine Stunde,
um neue Synapsen sprießen zu lassen.
Doch während der Schöpfer der Psychoanalyse sich das Gedächtnis statisch wie ein
Lagerregal vorstellte, in das man gravierte Wachstafeln ablegt, ist das heutige
Modell vom Gedächtnis ein dynamisches. Bei jedem Abruf einer Erinnerung
versehen wir diese mit einem neuen Kontext und verändern dadurch ihre Gestalt.
"Aus der Neurobiologie wissen wir, dass man Erfahrungen nie löschen kann", sagt
Leuzinger-Bohleber - schon gar nicht, indem man, wie Freud es versuchte, an die
Vernunft des Patienten appelliert. "Es nützt dem Patienten nicht viel, wenn man
''nur'' seine Lebensgeschichte rekonstruiert und erfährt, dass er im Alter von zwei
Jahren ein Trauma erlebte. Nimmt man ernst, was die Neurowissenschaftler sagen,
dann muss er seine Konflikte wiedererleben und in der Beziehung mit dem
Analytiker eine neue emotionale Erfahrung machen. Dadurch kann sich ein neues,
korrektives neuronales Netz bilden."
Am Freud-Institut haben erste Versuchsreihen mit Hirnscans ermutigende
Ergebnisse gezeigt. Doch was ist auf den Röntgenaufnahmen der Seele wirklich zu
erkennen? Gehirne seien anatomisch so individuell wie Ohrmuscheln und daher
schwer zu vergleichen, schränkt die Institutschefin die Aussagekraft der Bilder ein.
Und was im Scan am hellsten leuchte, müsse noch lange nicht die bedeutendste
Aktivität sein.
DIE WISSENSCHAFT VOM TRAUM
Von der Couch ins Labor verlagert sich auch die Erforschung des Traums, für Freud
der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten. Wenn der Psychologe Stephan Hau
im Keller des Sigmund-Freud-Instituts mit Hilfe des EEGs seziert, was die Gehirne
seiner Testschläfer hervorbringen, geht es allerdings kaum um die Deutung der
nächtlichen Hirngespinste. Hau will herausfinden, wozu Träume gut sind. Darüber
hat die Hirn-forschung einige Theorien gebildet.
Aus evolutionstheoretischer Sicht etwa durchlebt der Schläfer die wirren Streifen
als Trainingslager: Indem er die Prüfung verpasst, mit dem Fahrrad in den Abgrund
rast oder gegen gefährliche Tiere kämpft, probt er den täglichen Überlebenskampf.
Wer träumt, besagen andere Theorien, verarbeitet dabei Stress oder konsolidiert
sein Gedächtnis. Um Erinnerungsforschung geht es auch in einigen der Experi-
mente, die Hau betreibt: Welche Reize gelangen überhaupt ins Bewusstsein? Wie
zerlegt sie der Traum und arbeitet sie in neue Zusammenhänge ein?
Hau hat gezeigt, wie Wahrnehmungssplitter vom Tag ins Traumgeschehen geraten,
ein Vorgang, den Neurowissenschaftler "vorbewusstes Processing" nennen.
Subliminal, also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von einer 150stel Sekunde,
präsentierte er Probanden vor dem Einschlafen eine Strandszene, auf der ein Haus
mit einem drei-eckigen roten Dach zu sehen war. Wenn die Schläfer ihre Träume
zeichneten, tauchten auf den Bildern rote Dreiecke auf, für die sie keine Erklärung
hatten.
Zurzeit sucht Hau nach Hinweisen auf den Mechanismus der Abwehr - nach Freud
ein unbewusster Vorgang, mit dem wir unangenehme Inhalte von uns fern halten.
Probanden bekamen - wiederum subliminal - ein beunruhigendes fledermaus-
artiges Gebilde zu sehen. Bat der Psychologe sie, im Wachzustand freie Einfälle zu
schildern, hatte der Reiz darauf offenbar keinen Einfluss. In ihren Träumen
hingegen wurden die Testpersonen anschließend von Angstszenarios wie Raub-
vögeln oder unheimlichen Landschaften heimgesucht.
Gemeinsam mit Kollegen vom Zentrum für Neurologie der Uni Frankfurt steckte
Hau schon Testschläfer in die Kernspinröhre, um die Traumaktivität beim Ein-
schlafen zu untersuchen. "Rückschlüsse auf den Trauminhalt oder dessen
Bedeutung sind allerdings nicht möglich", sagt Hau. "Die Lücke zwischen
Physiologie und Psychologie lässt sich auch mit den präzisesten Bildgebungs-
verfahren nicht schließen."
Auch Freuds Behauptung, beim Traum handle es sich stets um eine - sexuelle -
Wunscherfüllung, lässt sich auf diese Weise nicht überprüfen. Die Freudschen
Traumtheorien erleben gleichwohl eine neurowissenschaftliche Wiederauf-
erstehung. Kaum ein Forscher würde heute mehr behaupten, Träume seien nur
zufällige Entladungen unseres Gehirns. Dieses Dogma hatte der US-amerikanische
Psychiater J. Allan Hobson in den siebziger Jahren aufgestellt und damit Freuds
Traumtheorie der Lächerlichkeit preisgegeben.
Hobson glaubte, im REM-Schlaf (Rapid Eye Movement) das physiologische
Korrelat des Traums gefunden zu haben. Er wies nach, dass der Schlafzyklus, der
mit schnellen Augenbewegungen einhergeht, durch Ausschüttung von Acetylcholin
im Hirnstamm reguliert wird - einer Region, die mit psychischer Aktivität kaum
zusammenhängt. Träume seien folglich nichts als chaotische Reaktionen höherer
Gehirnregionen auf die Flut von Acetylcholin. Der angebliche Schlüssel zur Seele -
nur ein bedeutungsloses Rauschen im Hirn.
Vor wenigen Jahren jedoch fand Mark Solms heraus, dass seine Patienten, die
aufgrund einer Hirnverletzung keinen REM-Schlaf mehr hatten, sehr wohl
träumten. Träumen und REM-Schlaf konnten also nicht dasselbe sein. Traumlos
schliefen dagegen jene Patienten, bei denen Nervenbahnen tief im Inneren des
Mittelhirns zerstört waren - eine Region, die der USamerikanische Verhaltens-
neurologe Jaak Panksepp als Sitz des sogenannten Belohnungs- oder Suchsystems
identifiziert hat. Dieser Dopamin-Schaltkreis, den Hirnforscher am ehesten mit
Freuds "Libido" vergleichen, fungiert nach der gegenwärtig einflussreichsten
Hypothese als Traumgenerator. Es scheint also, als behalte Freud insofern recht, als
Wünsche zumindest ein starker Motor des Traums sind - allerdings spielt die
Sexualität dabei eine weitaus geringere Rolle, als Freud glaubte.
Auch am zweiten Grundpfeiler seiner Traumtheorie, nach dem die sogenannte
Traumzensur dazu führt, dass der Schläfer peinliche Motive im Traum symbolisch
"entschärft" - er meint "Phallus", träumt aber "Zigarre" -, hatten sich früh Zweifel
geregt: Weshalb, fragte der Schriftsteller George Orwell, solle er wohl im Schlaf Sex-
impulse schamhaft kaschieren, "über die ich im Wachzustand ohne jede Scheu
sprechen würde?" Tatsächlich sehen heutige Psychoanalytiker in Freuds Fixierung
auf das Sexuelle auch den Nachhall einer lustfeindlichen Epoche.
Ist eine geträumte Zigarre also doch einfach nur eine Zigarre, wie Hobson und
andere Gegner der Traumdeutung postulieren? "Manchmal schon", vermutet Mark
Solms. Aber er hat eine neurologische Entsprechung zu diesem Austausch-
mechanismus der Traummotive entdeckt, den Freud "Verschiebung" nannte: Einige
seiner Patienten, die unter extremen Gedächtnislücken leiden, füllen ihre
biografischen Abgründe mit traumartig erfundenen Erzählungen, sogenannten
Konfabulationen. Biochemisch ist das Gehirn dieser Patienten in einem ähnlichen
Zustand wie das von Träumenden. Auch manche Drogen können solche Zustände
hervorrufen. Die meisten Neurologen sagen: "Der Patient konfabuliert, er redet
Unsinn." Der Analytiker fragt: "Warum sagt er gerade das?"
Solms erinnert sich an einen Patienten, dem bei einer Tumoroperation Hirngewebe
entfernt worden war. Der Mann wusste danach nicht mehr, wer er war. In zwölf
aufeinander folgenden Sitzungen konnte er sich nicht erinnern, Solms jemals zuvor
gesehen zu haben. Abwechselnd sprach er ihn als seinen Kneipenkumpel an, als
Automechaniker, der einen seiner Sportwagen reparieren solle (die er gar nicht
besaß), oder als Sportkameraden. Eines Tages begrüßte er Solms als seinen
Zahnarzt und schüttelte ihm überschwänglich die Hand.
Vieles klang schlicht verrückt, aber als Solms mit der Frau des Patienten sprach,
erzählte sie, dass ihr Mann während seiner College-Zeit begeisterter Ruderer
gewesen sei. Jahre zuvor hatte ihn eine Operation, bei der er Zahnimplantate
bekam, von fürchterlichen Schmerzen befreit. Das Ganze ergab also doch einen
Sinn.
Eines Tages fasste sich der Mann an den Kopf und sagte: "Ein Stück im Computer
fehlt: Modul C 49."
"Was macht C 49?", fragte Solms.
"Es ist ein Gedächtnismodul. Ich habe es neulich checken lassen, es hatte immer ein
paar Takte zu wenig. Jetzt haben sie Implantate eingesetzt, und alles läuft wieder
tadellos. Aber ehrlich gesagt, ich habe das Ding sowieso nie gebraucht."
Was der Mann mit der Geschichte vom defekten Computermodul meinte, war für
Solms leicht zu deuten: "Es dämmerte ihm, dass etwas mit seinem Gedächtnis nicht
stimmt. Diese schockierende Einsicht wischte er beiseite und kreierte sich eine
Realität, die er ertragen konnte."
Die traumähnlichen Konfabulationen, das hat Solms auch in Experimenten mit
Patienten gezeigt, sind keineswegs zufällig, sondern wunscherfüllt. Das Gehirn neigt
in bestimmten funktionalen Zuständen offensichtlich dazu, die eigentliche
Geschichte metaphorisch zu verpacken - und sei es nur, weil der Erinnerungs-
suchmechanismus fehlerhaft arbeitet.
"Das beweist nicht Freuds Idee von der Traumverschiebung als motiviertem Akt.
Aber es macht vielleicht ein bisschen erträglicher, was die Psychoanalyse über
Träume sagt."
J. Allan Hobson, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, hält
solche Argumente freilich für den nutzlosen Versuch, moderne Daten nachträglich
an einen veralteten theoretischen Rahmen anzupassen. Noch so viel "neurobio-
logische Flickschusterei" ändere nichts daran, dass sich die Psychoanalyse in großen
Schwierig-keiten befinde. Freuds Rückkehr durch die Hintertür der Hirnforschung
ist für viele seiner Kollegen ein Alptraum: "Erforderlich wäre eine derart radikale
Generalüberholung, dass viele Neurowissenschaftler lieber ein von Grund auf neues
neurokognitives Modell der Psyche entwickeln möchten."
FREUD ENTRÜMPELN
Schon jetzt haben Psychoanalytiker und Naturwissenschaftler - gemeinsam - viele
von Freuds Thesen über Bord geworfen. Nicht zuletzt hat sich die Vorstellung vom
Unbewussten gewandelt.
Wenn Hirnforscher heute von unbewusst ablaufenden Prozessen reden, meinen sie
häufig gar nicht verdrängte Erinnerungen, die unser Verhalten bestimmen, sondern
sehr viel banalere Dinge: Kein Mensch etwa denkt beim Sprechen bewusst daran,
wie er einzelne Wörter zu Sätzen formt. Auto fahren, Schleife binden, Butterbrot
essen, dies alles funktioniert automatisch, ohne dass unser Hippocampus aktiv
werden muss, der für das Abspeichern bewusster Erinnerungen zuständig ist.
Dieses implizite, unbewusste Wissen entspricht am ehesten dem, was Freud als
"Vorbewusstes" bezeichnete.
Mit anderen Augen betrachten Wissenschaftler heute aber auch das "dynamische
Unbewusste", jenen dunklen Kontinent der Seele, den Freud einmal das "innere
Afrika" nannte, bevölkert von einer "psychischen Urbevölkerung", gegen die das
vernünftige Ich ein Leben lang ankämpfen müsse. "Aus Es muss Ich werden", lautet
einer seiner berühmtesten Lehrsätze.
"Man muss das Unbewusste positiver sehen", hält der Bremer Hirnforscher
Gerhard Roth dagegen. "Das Es bedroht nicht das Ich, sondern das Es leitet das
Ich." Das Unbewusste sei eine überwiegend nützliche Instanz. In jeder Sekunde
melde es sich zu Wort bei der Frage: Soll ich das tun, oder soll ich das nicht tun?
"Das Unbewusste trifft seine Entscheidungen vor dem Hintergrund aller Vor-
erfahrungen, die unser Gehirn seit dem Mutterleib gemacht hat. So gesehen ist es
der Ort einer größeren, weil die gesamte Lebenserfahrung umfassenden Vernunft."
Gegenwind spüren die Verfechter der Freudschen Entwicklungstheorie: Der
renommierte Säuglingsforscher Daniel Stern gab vor einigen Jahren zu Protokoll, er
halte Freuds Stufenmodell von der oralen, analen und ödipalen Phase des
Kleinkinds für "schlicht falsch". Als überholt gelten auch die Triebtheorie des
Altmeisters und etliche seiner Annahmen über das Gedächtnis oder die Psyche der
Frau. Stark bezweifelt wird die Existenz eines Todestriebs, dessen Wirken Freud in
jedem Menschen vermutete.
"Kein bildgebendes Verfahren wird jemals den Beweis für den Penisneid finden
oder ein Ich, Es und Über-Ich, verstrickt in einen unendlichen Machtkampf", sagt
Solms. Ihm geht es nicht darum, zu beweisen, dass Freud recht hatte - noch nicht
mal darum, die Psychoanalyse als Therapiemethode zu retten.
Der ganze ideologische Ballast, fordert Solms, die ganzen Regeln: weg damit! Die
Psychoanalyse selbst sei nicht wichtig, sie beschäftige sich nur mit etwas
Wichtigem: mit der menschlichen Seele als Teil der Natur. "Freud hat versucht, eine
Sprache und eine Methode für die Wissenschaft vom Innenleben zu finden. Er hat
eine Art Basis-Topografie der Seele und ihrer grundlegenden Bestandteile
geschaffen." Eine bessere gebe es bisher nicht.
CHEMIE DER ERINNERUNG
Hans Markowitsch sucht auf den farbigen Aufnahmen von den Gehirnen seiner
Patienten nach neurobiologischen Erklärungen für Phänomene, die sich mit
psychoanalytischen Konzepten wie "Abwehr" oder "Verdrängung" zumindest sehr
gut beschreiben lassen. Markowitsch untersucht als Hirnforscher an der Uni
Bielefeld Menschen, denen ihr Gedächtnis abhanden gekommen ist - einfach so,
ohne eine Verletzung.
So hat er einen Mann kennen gelernt, der bis nach Sibirien reiste, ohne zu wissen,
warum. Ein anderer wollte Brötchen holen und fuhr mit dem Fahrrad vom Ruhr-
gebiet bis nach Frankfurt am Main: "Er konnte sich an nichts mehr erinnern, nicht
mal an den Namen seiner Frau. Sah er in Schaufensterscheiben sein Spiegelbild,
blickte ihm ein fremdes Gesicht entgegen. Verflogen waren sein Asthma und seine
Allergie."
Was war geschehen? Markowitsch fand heraus, dass die Mutter dieses Mannes ihn
als Kind in Mädchenkleider gesteckt und als Versager hingestellt hatte. Später hatte
er eine Frau geheiratet, die das Ebenbild seiner Mutter war. Sie hatte prophezeit, er
werde seine Firma ruinieren, und genau das war eingetreten. Für den teuren
Familien-urlaub, den ihm seine Frau aufgenötigt hatte, fehlte nun das Geld. Drei
Tage vor Urlaubsantritt setzte er sich aufs Rad.
Mehr als ein Dutzend solcher Patienten hat Markowitsch untersucht. "Bei allen
finden wir extrem schlechte Kindheitserfahrungen", sagt der Neurobiologe. "Das
hat ja schon Freud vermutet."
Markowitsch hat eine biologische Erklärung dafür, warum solche Erfahrungen das
ganze Leben überschatten können: "Traumatische Erlebnisse verstellen im
kindlichen Gehirn biochemische Schrauben. Ständig herrscht ein erhöhter Level
von Stresshormonen, der eine dauerhaft erhöhte Empfindlichkeit hervorruft." Im
Erwachsenenalter werden dann bereits bei kleineren Stressereignissen ganze
Hormonkaskaden freigesetzt, die den normalen Informationsfluss - und auch das
Gedächtnis - blockieren können.
Wenn uns unser erster Kuss oder die Zeugnisausgabe einfällt, setzt das Gehirn diese
autobiografische Erinnerung aus zwei unterschiedlichen Teilen zusammen: Die
Sachinformation holt es aus dem Hippocampus, die dazugehörigen Gefühle von der
Amygdala. Genau in diesen Regionen des limbischen Systems sitzen auch die
meisten Rezeptoren für Stresshormone. Überfluten die Hormone das Gehirn und
docken in Hippocampus und Amygdala an, verhindert dies das Zusammenfügen der
Erinnerung.
Markowitsch hat Patienten erlebt, bei denen eine Depression ein solches
"mnestisches Blockadesyndrom" hervorrief. Ein schwermütiger Werbemanager
rutschte nach und nach in einen so umfassenden Gedächtnisverlust, dass er seinen
Beruf nicht mehr ausüben konnte.
Bei traumatischen Erlebnissen hingegen verschwinden oft nur die Erinnerungen an
deren Details. Es bleibt das Gefühl: "Da ist irgendetwas Schreckliches." So erging es
einem anderen Patienten aus seiner Praxis: Ein 23-jähriger Banker entdeckte einen
harmlosen Kellerbrand. Sein Freund rief die Feuerwehr, die den Brand löschte. Als
der Mann am nächsten Morgen aufwachte, waren die letzten sechs Jahre seines
Lebens aus seinem Gedächtnis ausradiert.
Im Laufe seiner Therapie berichtete er, dass offenes Feuer für ihn eine
lebensbedrohliche Situation darstelle: Er hatte als Vierjähriger mit angesehen, wie
jemand in einem Auto bei lebendigem Leib verbrannte. Das Feuer im Keller musste
die Erinnerung an dieses Trauma und damit einen Schwall von Stresshormonen
aktiviert haben, die durch Andocken an Rezeptoren limbischer Nervenzellen den
Informationsfluss zum Kollaps brachten.
Für Psychoanalytiker ist das ein alter Hut: Gedächtnisverlust als Notfall-
mechanismus sozusagen, ausgelöst durch eine Erinnerungsspur, die ins Zentrum
der verdrängten traumatischen Erfahrung reicht. Für die Hirnforschung hingegen
ist der Nachweis einer neurochemischen Zündschnur, die vom Kleinkindgehirn
direkt in die Gegenwart des Erwachsenen führt, eine vergleichsweise neue
Erkenntnis.
Psychisch bedingter Gedächtnisverlust gilt unter Neurologen als besonders
therapieresistent. Aber vielleicht liegt das auch an der Therapie? Die Neuro-
psychologie versucht gewöhnlich, das Symptom mit systematischem Gedächtnis-
training zu beseitigen. Der Analytiker dagegen versteht das Symptom als Botschaft
aus dem Unbewussten. Es verweist nur auf etwas Tieferliegendes. Selbst wenn der
Fahrradfahrer sein Gedächtnis zurückbekäme, wäre sein Problem nicht gelöst.
Seine Patienten haben Hirnforscher Markowitsch nachdenklich gemacht. Dringend
brauche man in der Psychiatrie und Neurologie alternative Behandlungswege,
welche die Persönlichkeitskonstellation des Patienten berücksichtigen, sagt er.
Vielleicht die Psychoanalyse?
Markowitsch ist skeptisch. Er kennt Patienten, denen die Redekur geholfen hat.
Aber gerade dort, wo besonders monströse Erinnerungen lauern, hat er das Gefühl,
es sei manchmal hilfreicher, die Behandlung auf die zukünftige Lebenssituation
eines Patienten auszurichten, anstatt die schrecklichen Dinge aus der Vergangen-
heit hervorzugraben wie Knochen aus einem Massengrab.
Mark Solms ist anderer Meinung: Einer seiner Patienten hatte beispielsweise
versucht, sich aufzuhängen. In den letzten Jahren war der Mann ein schwerer
Trinker gewesen. Er hatte seinen Job verloren, seine Mutter war gestorben, dann
starb sein Vater in seinen Armen. All dies geschah kurz vor dem Selbstmord-
versuch. Danach hatte er all diese Ereignisse vergessen. Der Mann war aber
keineswegs guter Dinge gewesen. Wie ein Schiff ohne Anker trieb er durch den
Ozean seiner traurigen Ahnungen. Er begriff nicht, warum er sich so hilflos,
verloren und allein fühlte.
"Wir brauchen unsere Erinnerung, auch wenn sie kaum zu ertragen ist", sagt Solms.
"Wenn wir nicht wissen, woher unsere Gefühle kommen, können wir keine Lösung
finden."
Solms ist nicht nur Theoretiker. Er verbrachte selbst elf Jahre auf der Couch. Sein
Bruder war als Fünfjähriger vom Dach eines Hauses gefallen und hatte sich schwer
am Kopf verletzt. Als er nach Monaten aus dem Hospital zurückkehrte, war er ein
anderer Mensch.
"All diese Patienten leiden an ihrer Unfähigkeit nicht weniger als jemand, mit
dessen Bewusstsein alles in Ordnung ist", sagt Solms. "Neurologische Patienten
bekommen äußerst selten Psychotherapie. Dabei brauchen sie besonders dringend
jemanden, der ihnen hilft, den Horror auszuhalten, den für sie die Berührung mit
der Realität bedeutet."
Seine Patientin Kate beispielsweise hat auf diese Weise allmählich eine gewisse
Orientierung in ihrem oszillierenden Bewusstsein erlangt. Kate ist Ende 50. Seit ein
Junkie ihr mit dem Golfschläger einen Schlag auf den Kopf versetzte, um sie zu
berauben, ist sie blind und gelähmt. Doch als Kate aus dem Koma erwachte, war sie
überzeugt, gehen und sehen zu können. Sie sah zum Beispiel einen fremden,
dunkelhäutigen Jungen, der oft an ihrem Bett stand. Kate schätzte ihn auf 12,
höchstens. Sie nannte ihn Pickie.
"Erzählen Sie von Pickie", sagt Solms. Kate strahlt: "Oh, er war so ein fröhlicher
kleiner Kerl. Eines Tages sagte ich zu ihm: ,Ich nenne dich Sonnenschein, genau so
sieht dein Lächeln aus.''" Dann wiegt sie sich im Rollstuhl vor und zurück: "Dabei
konnte ich ihn doch gar nicht sehen. Er war auch zu jung, um im Krankenhaus zu
arbeiten. Und Sie sagen, er sei wahrscheinlich eine Figur aus meiner Phantasie!"
Kate hatte Hilfe gesucht, weil sie überhaupt nicht mehr wusste, was los war. In ihrer
Familie glaubte niemand, dass sie gehen und sehen konnte. Alle widersprachen ihr
ständig. Es war ein einsamer Kampf ohne Ende. Bei Solms hat sie sich alles von der
Seele geredet. Irgendwann begann sie zu akzeptieren, dass sie blind ist, auch wenn
es ihr manchmal anders vorkommt. Neulich sah sie zum Beispiel ein Fahrrad vom
Himmel hängen. "Dann mache ich die Augen auf, und alles ist wie Kohle da
draußen. Es ist schrecklich. Wenn ich nur sehen könnte, wären all meine Probleme
gelöst."
Verglichen damit war es eine rosige Zeit damals mit dem kleinen Pickie in der
Klinik. Andererseits hat sich zu Hause die Lage in mancher Hinsicht hoffnungsvoll
entwickelt, seit Kate wieder Bodenkontakt hat. Zum ersten Mal seit dem ganzen
Drama hat sie bei ihrer Tochter angerufen.
Kate will versuchen, ihrer Enkelin eine Großmutter zu sein: eine blinde und
gelähmte Großmutter, die nicht ganz richtig im Kopf ist. Es hat sie enorme
Überwindung gekostet, das zu akzeptieren. "Aber vielleicht habe ich ja eine Zukunft
mit diesem Kind", sagt sie. Immerhin existiert es wirklich.
BEATE LAKOTTA
* Die Namen aller Patienten sind geändert. * Karen Kaplan-Solms, Mark Solms: "Neuro-Psychoanalyse.
Eine Einführung mit Fallstudien". Klett-Cotta, Stuttgart; 312 Seiten; 34 Euro. / Mark Solms, Oliver
Turnbull: "Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyse". Walter-Verlag,
Düsseldorf; 360 Seiten; 34,90 Euro. * Klaus Grawe: "Neuropsychotherapie". Hogrefe-Verlag, Göttingen; 512
Seiten; 39,95 Euro. * "Der Nachtmahr", Gemälde von Johann Heinrich Füssli (1782). * Szene aus "Der
Stadtneurotiker" (1977) mit Diane Keaton, Woody Allen als Patienten und Humphrey Davis als Psychiater.
Quelle: DER SPIEGEL 16/2005






DER SCANNER AN DER
COUCH
"Freuds größte Entdeckung aber war,
dass Worte heilen können", sagt
Marianne Leuzinger-Bohleber. "Er hat
sie zu einer Zeit gemacht, in der
traumatisierte Front-soldaten noch mit
Zwangsexerzieren und Elektroschocks
behandelt wurden."
Dass Psychotherapie das Gehirn ebenso
verändern kann wie ein
Psychopharmakon, haben Tomografie-
Studien bei Depressionskranken gezeigt.
In deren Gehirn ist der Hippocampus
geschrumpft und der cinguläre Cortex -
der Konfliktmotor des Gehirns, der
anspringt, wenn der Mensch in
Schwierigkeiten gerät - lahm gelegt. Mit
der Überwindung der Depression erholt
sich das Gehirn wieder.
Aber ob die Psychoanalyse einen solchen
Umbau der Neuronen in Gang setzen
kann? Der Berner Psychologe Klaus
Grawe ist skeptisch: "Dafür muss das
Gehirn ungemein systematisch und
zielgerichtet aktiviert werden.
Eingespielte Erfahrun-gen müssen
gehemmt, neue Erfahrungen müssen
immer wieder wiederholt werden", meint
der Analyse-Kritiker, der gerade ein Buch
über die neuronalen Grundlagen der
Psycho-therapie geschrieben hat*. "Mit
der klassischen psychoanalytischen
Haltung: ''Mal sehen, was heute vom
Patienten kommt'' ist das unvereinbar."
Die Leiterin des Freud-Instituts verweist
auf andere Erfahrungen. Einige wenige
Patienten, vielleicht fünf Prozent, hätten
gar keinen inneren Spielraum, in dem
solche zielgerichteten Methoden greifen
könnten. Sie seien so schwer gestört, dass
sie einer gründlichen, lang andauernden
Therapie bedürften.
Leuzinger-Bohleber analysierte
beispielsweise eine junge Frau, die mit
blutig gekratzten Händen zur ersten
Sitzung kam. Sie lebte völlig isoliert in
einer dunklen Wohnung, litt unter einem
Waschzwang, schwersten Panikattacken
und war wegen ihrer Magersucht in
mehreren Kliniken vergeblich mit
Verhaltens- und Gesprächs-
psychotherapie behandelt worden.
Nach zwei Jahren Analyse war sie bereit,
ihre Mutter nach den Umständen ihrer
ersten Lebensjahre zu fragen. Sie erfuhr,
dass die Mutter versucht hatte, sie
abzutreiben. Ein Zwillingsbruder starb
bei der Geburt, die Mutter versank in
Depression. Der Vater hatte den Sohn
gewollt und lehnte die Tochter ab.
"Wenn wir davon ausgehen", sagt
Leuzinger-Bohleber, "dass sich die
neuronalen Netze unseres emotionalen
Gedächtnisses schon im Mutterleib
ausbilden, dann ergibt es einen Sinn,
dass die junge Frau Nähe mit Gefühlen
wie Panik, Fallen-gelassenwerden,
Todesangst zusammenbrachte."
Die junge Frau aus Leuzinger-Bohlebers
Praxis zog am Ende aus ihrer
schrecklichen Wohnung aus und fand
sogar einen Partner. Die Analytikerin ist
überzeugt: "Wenn wir ihr Gehirn vorher
und nachher gescannt hätten, wäre die
Veränderung sichtbar geworden."
Freud hatte postuliert, Gedächtnis sei
eine "Haupteigenschaft des
Nervengewebes". Dieses könne "durch
einmalige Vorgänge dauerhaft verändert"
werden. Tatsächlich hat die
Hirnforschung materielle Korrelate der
Erinnerung gefunden: Als Eric Kandel in
den achtziger Jahren untersuchte, wie
das Gedächtnis der Meeresschnecke
Aplysia auf Berührung ihrer Kiemen
reagiert, reichte schon eine Stunde, um
neue Synapsen sprießen zu lassen.
Doch während der Schöpfer der
Psychoanalyse sich das Gedächtnis
statisch wie ein Lagerregal vorstellte, in
das man gravierte Wachstafeln ablegt, ist
das heutige Modell vom Gedächtnis ein
dynamisches. Bei jedem Abruf einer
Erinnerung versehen wir diese mit einem
neuen Kontext und verändern dadurch
ihre Gestalt.
"Aus der Neurobiologie wissen wir, dass
man Erfahrungen nie löschen kann", sagt
Leuzinger-Bohleber - schon gar nicht,
indem man, wie Freud es versuchte, an
die Vernunft des Patienten appelliert. "Es
nützt dem Patienten nicht viel, wenn man
''nur'' seine Lebensgeschichte
rekonstruiert und erfährt, dass er im
Alter von zwei Jahren ein Trauma
erlebte. Nimmt man ernst, was die
Neurowissenschaftler sagen, dann muss
er seine Konflikte wiedererleben und in
der Beziehung mit dem Analytiker eine
neue emotionale Erfahrung machen.
Dadurch kann sich ein neues, korrektives
neuronales Netz bilden."
Am Freud-Institut haben erste
Versuchsreihen mit Hirnscans
ermutigende Ergebnisse gezeigt. Doch
was ist auf den Röntgenaufnahmen der
Seele wirklich zu erkennen? Gehirne
seien anatomisch so individuell wie
Ohrmuscheln und daher schwer zu
vergleichen, schränkt die Institutschefin
die Aussagekraft der Bilder ein. Und was
im Scan am hellsten leuchte, müsse noch
lange nicht die bedeutendste Aktivität
sein.
DIE WISSENSCHAFT VOM TRAUM
Von der Couch ins Labor verlagert sich
auch die Erforschung des Traums, für
Freud der Königsweg zur Kenntnis des
Unbewussten. Wenn der Psychologe
Stephan Hau im Keller des Sigmund-
Freud-Instituts mit Hilfe des EEGs
seziert, was die Gehirne seiner
Testschläfer hervorbringen, geht es
allerdings kaum um die Deutung der
nächtlichen Hirngespinste. Hau will
herausfinden, wozu Träume gut sind.
Darüber hat die Hirn-forschung einige
Theorien gebildet.
Aus evolutionstheoretischer Sicht etwa
durchlebt der Schläfer die wirren Streifen
als Trainingslager: Indem er die Prüfung
verpasst, mit dem Fahrrad in den
Abgrund rast oder gegen gefährliche
Tiere kämpft, probt er den täglichen
Überlebenskampf. Wer träumt, besagen
andere Theorien, verarbeitet dabei Stress
oder konsolidiert sein Gedächtnis. Um
Erinnerungsforschung geht es auch in
einigen der Experimente, die Hau
betreibt: Welche Reize gelangen
überhaupt ins Bewusstsein? Wie zerlegt
sie der Traum und arbeitet sie in neue
Zusammenhänge ein?
Hau hat gezeigt, wie
Wahrnehmungssplitter vom Tag ins
Traumgeschehen geraten, ein Vorgang,
den Neurowissenschaftler "vorbewusstes
Processing" nennen. Subliminal, also
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle
von einer 150stel Sekunde, präsentierte
er Probanden vor dem Einschlafen eine
Strandszene, auf der ein Haus mit einem
dreieckigen roten Dach zu sehen war.
Wenn die Schläfer ihre Träume
zeichneten, tauchten auf den Bildern rote
Dreiecke auf, für die sie keine Erklärung
hatten.
Zurzeit sucht Hau nach Hinweisen auf
den Mechanismus der Abwehr - nach
Freud ein unbewusster Vorgang, mit dem
wir unangenehme Inhalte von uns fern
halten. Probanden bekamen - wiederum
subliminal - ein beunruhigendes
fledermausartiges Gebilde zu sehen. Bat
der Psychologe sie, im Wachzustand freie
Einfälle zu schildern, hatte der Reiz
darauf offenbar keinen Einfluss. In ihren
Träumen hingegen wurden die
Testpersonen anschließend von
Angstszenarios wie Raub-vögeln oder
unheimlichen Landschaften
heimgesucht.
Gemeinsam mit Kollegen vom Zentrum
für Neurologie der Uni Frankfurt steckte
Hau schon Testschläfer in die
Kernspinröhre, um die Traumaktivität
beim Einschlafen zu untersuchen.
"Rückschlüsse auf den Trauminhalt oder
dessen Bedeutung sind allerdings nicht
möglich", sagt Hau. "Die Lücke zwischen
Physiologie und Psychologie lässt sich
auch mit den präzisesten Bildgebungs-
verfahren nicht schließen."
Auch Freuds Behauptung, beim Traum
handle es sich stets um eine - sexuelle -
Wunscherfüllung, lässt sich auf diese
Weise nicht überprüfen. Die Freudschen
Traumtheorien erleben gleichwohl eine
neurowissenschaftliche Wiederauf-
erstehung. Kaum ein Forscher würde
heute mehr behaupten, Träume seien nur
zufällige Entladungen unseres Gehirns.
Dieses Dogma hatte der US-
amerikanische Psychiater J. Allan
Hobson in den siebziger Jahren
aufgestellt und damit Freuds
Traumtheorie der Lächerlichkeit
preisgegeben.
Hobson glaubte, im REM-Schlaf (Rapid
Eye Movement) das physiologische
Korrelat des Traums gefunden zu haben.
Er wies nach, dass der Schlafzyklus, der
mit schnellen Augenbewegungen
einhergeht, durch Ausschüttung von
Acetylcholin im Hirnstamm reguliert
wird - einer Region, die mit psychischer
Aktivität kaum zusammenhängt. Träume
seien folglich nichts als chaotische
Reaktionen höherer Gehirnregionen auf
die Flut von Acetylcholin. Der angebliche
Schlüssel zur Seele - nur ein
bedeutungsloses Rauschen im Hirn.
Vor wenigen Jahren jedoch fand Mark
Solms heraus, dass seine Patienten, die
aufgrund einer Hirnverletzung keinen
REM-Schlaf mehr hatten, sehr wohl
träumten. Träumen und REM-Schlaf
konnten also nicht dasselbe sein.
Traumlos schliefen dagegen jene
Patienten, bei denen Nervenbahnen tief
im Inneren des Mittelhirns zerstört
waren - eine Region, die der
USamerikanische Verhaltens-neurologe
Jaak Panksepp als Sitz des sogenannten
Belohnungs- oder Suchsystems
identifiziert hat. Dieser Dopamin-
Schaltkreis, den Hirnforscher am ehesten
mit Freuds "Libido" vergleichen, fungiert
nach der gegenwärtig einflussreichsten
Hypothese als Traumgenerator. Es
scheint also, als behalte Freud insofern
recht, als Wünsche zumindest ein starker
Motor des Traums sind - allerdings spielt
die Sexualität dabei eine weitaus
geringere Rolle, als Freud glaubte.
Auch am zweiten Grundpfeiler seiner
Traumtheorie, nach dem die sogenannte
Traumzensur dazu führt, dass der
Schläfer peinliche Motive im Traum
symbolisch "entschärft" - er meint
"Phallus", träumt aber "Zigarre" -, hatten
sich früh Zweifel geregt: Weshalb, fragte
der Schriftsteller George Orwell, solle er
wohl im Schlaf Seximpulse schamhaft
kaschieren, "über die ich im
Wachzustand ohne jede Scheu sprechen
würde?" Tatsächlich sehen heutige
Psychoanalytiker in Freuds Fixierung auf
das Sexuelle auch den Nachhall einer
lustfeindlichen Epoche.
Ist eine geträumte Zigarre also doch
einfach nur eine Zigarre, wie Hobson und
andere Gegner der Traumdeutung
postulieren? "Manchmal schon",
vermutet Mark Solms. Aber er hat eine
neurologische Entsprechung zu diesem
Austauschmechanismus der
Traummotive entdeckt, den Freud
"Verschiebung" nannte: Einige seiner
Patienten, die unter extremen
Gedächtnislücken leiden, füllen ihre
biografischen Abgründe mit traumartig
erfundenen Erzählungen, sogenannten
Konfabulationen. Biochemisch ist das
Gehirn dieser Patienten in einem
ähnlichen Zustand wie das von
Träumenden. Auch manche Drogen
können solche Zustände hervorrufen. Die
meisten Neurologen sagen: "Der Patient
konfabuliert, er redet Unsinn." Der
Analytiker fragt: "Warum sagt er gerade
das?"
Solms erinnert sich an einen Patienten,
dem bei einer Tumoroperation
Hirngewebe entfernt worden war. Der
Mann wusste danach nicht mehr, wer er
war. In zwölf aufeinander folgenden
Sitzungen konnte er sich nicht erinnern,
Solms jemals zuvor gesehen zu haben.
Abwechselnd sprach er ihn als seinen
Kneipenkumpel an, als Automechaniker,
der einen seiner Sportwagen reparieren
solle (die er gar nicht besaß), oder als
Sportkameraden. Eines Tages begrüßte
er Solms als seinen Zahnarzt und
schüttelte ihm überschwänglich die
Hand.
Vieles klang schlicht verrückt, aber als
Solms mit der Frau des Patienten sprach,
erzählte sie, dass ihr Mann während
seiner College-Zeit begeisterter Ruderer
gewesen sei. Jahre zuvor hatte ihn eine
Operation, bei der er Zahnimplantate
bekam, von fürchterlichen Schmerzen
befreit. Das Ganze ergab also doch einen
Sinn.
Eines Tages fasste sich der Mann an den
Kopf und sagte: "Ein Stück im Computer
fehlt: Modul C 49."
"Was macht C 49?", fragte Solms.
"Es ist ein Gedächtnismodul. Ich habe es
neulich checken lassen, es hatte immer
ein paar Takte zu wenig. Jetzt haben sie
Implantate eingesetzt, und alles läuft
wieder tadellos. Aber ehrlich gesagt, ich
habe das Ding sowieso nie gebraucht."
Was der Mann mit der Geschichte vom
defekten Computermodul meinte, war für
Solms leicht zu deuten: "Es dämmerte
ihm, dass etwas mit seinem Gedächtnis
nicht stimmt. Diese schockierende
Einsicht wischte er beiseite und kreierte
sich eine Realität, die er ertragen
konnte."
Die traumähnlichen Konfabulationen,
das hat Solms auch in Experimenten mit
Patienten gezeigt, sind keineswegs
zufällig, sondern wunscherfüllt. Das
Gehirn neigt in bestimmten funktionalen
Zuständen offensichtlich dazu, die
eigentliche Geschichte metaphorisch zu
verpacken - und sei es nur, weil der
Erinnerungs-suchmechanismus
fehlerhaft arbeitet.
"Das beweist nicht Freuds Idee von der
Traumverschiebung als motiviertem Akt.
Aber es macht vielleicht ein bisschen
erträglicher, was die Psychoanalyse über
Träume sagt."
J. Allan Hobson, Professor für
Psychiatrie an der Harvard Medical
School, hält solche Argumente freilich für
den nutzlosen Versuch, moderne Daten
nachträglich an einen veralteten
theoretischen Rahmen anzupassen. Noch
so viel "neurobiologische Flickschusterei"
ändere nichts daran, dass sich die
Psychoanalyse in großen Schwierig-
keiten befinde. Freuds Rückkehr durch
die Hintertür der Hirnforschung ist für
viele seiner Kollegen ein Alptraum:
"Erforderlich wäre eine derart radikale
Generalüberholung, dass viele
Neurowissenschaftler lieber ein von
Grund auf neues neurokognitives Modell
der Psyche entwickeln möchten."

































