
Heidelberg, Donnerstag, 25.07.1985, 18:00
Der grippale Infekt, oder was immer es sein mag, ist noch nicht vorüber, vielleicht aber der
Höhepunkt überschritten.
In den beiden vergangenen Tagen habe ich lediglich ein einziges Brötchen zu mir genommen,
und meine augenblickliche Schwäche dürfte auch darauf zurück zu führen sein. Vielleicht helfen
mir das Jägerschnitzel und der viertel Liter „Côtes du Rhône“ der „Zoogaststätte Garten“ über
den Damm.
In einer Jugendherberge krank zu sein, ist ekelhaft. Man kann sich nicht einmal einen Tee
bestellen, die Umgebung ist laut, und meine Mitreisenden sind mir auch keine Hilfe. Dies auch
noch bei herrlichem Wetter, wenn es von jungen Mädchen verwirrend wimmelt, mit
freiwippenden Brüsten in weit geschnittenen und auch weit ausgeschnittenen Hemden. Es ist
wunderschön hier, an diesem warmen Sommerabend, in dieser Gartenwirtschaft, mit Kiesboden,
mit alten Bäumen.
18:30
Ich begreife die Zusammenhänge nicht: Wenn ich krank und unsicher bin, beiße ich mir auf die
Zunge, dass der Schweiß ausbricht, klaut man mir, im Flugzeug, den Schal, den ich gegen das
Halsweh bräuchte, in der Duschkabine meine Haarshampoos, wo ich sie nur kurz habe liegen
lasse. Und dergleichen einiges mehr: Was soll das? Evolutionsbiologisch oder sonst irgendwie?
Berlin, Montag, 12.08.1985, 23:00
Dazu muss noch gesagt werden: Der Schal wurde geklaut in San Juan/Puerto Rico, geklaut bei
+33 °C und 90 % Luftfeuchtigkeit.
Mir würde vermutlich auch eine Badehose am Nordpol geklaut werden.
Frankfurt, Freitag, 23.08.1985, 18:00
Dumme Frauen öden mich an, machen mich krank. Es macht nicht mal Spaß, sie zu ficken.
Manchmal ganz selten, wenn man fünf bis sechs Biere drin hat.
Stuttgart, Dienstag, 27.08.1985, 23:00
In einer Pizzeria, allein. Isoliert mit Walkman, Kopfhörer, Mozarts “Don Giovanni”.
Seit zwei Tagen in dem, was man alte Heimat nennt, vermeintlich traute Umgebung, oder wo
man Bekannte oder gar Freunde besitzt.
Die Umgebung macht mich gereizt bis nervös, entschlusslos, antriebsschwach.
Aber vielleicht ist es nur das Tal nach dem Jahr Schule, nach den fünf Wochen Deutschlandfahrt
mit einem Bus voller Schüler.
Es scheint jedoch, dass die Zeit hier stehen geblieben ist. Es scheint kein Tag vergangen zu sein,
dass ich diese Umgebung verlassen habe. Nach den zurückgelegten Kilometern scheint sie mir
noch öder, noch weniger abwechslungsreich, schwerfällig. Neuerungen, Änderungen weit weg.
Weit weg neue Gesichter und neue Körper, ein interessantes Gespräch, ein interessantes
Gespräch, ein Flirt mit einem Mädchen oder besser noch mit einer Frau. Was habe ich mir
versprochen? Ängstlichkeit und Verkrampftheit sicher nicht. Ein spritziges Cabaret, ein lustiger
Film, ein Konzert, vielleicht eine Oper? Nun ja, nicht so ungeduldig, vielleicht findet sich noch ein
weibliches Wesen, das das einmal oder mehrere Male mit mir teilt, meinetwegen auch mehrere
Wesen.
Es ist bedauerlich, dass ich in den vergangenen Wochen und Monaten nicht die Muße oder
wenigstens Energie besessen habe, Geschehenes unmittelbar zu Papier zu bringen. Wesentlich
wäre gewesen, auf jeden Fall, die Cotopaxi-Besteigung mit Ri.. Ich will versuchen, den Vorgang
zu rekonstruieren, wenn auch schon geraume Zeit darüber vergangen ist.
Vorgenommen hatten wir uns eigentlich den Angriff auf den Illiniza Sur, den zweiten Versuch.
Jedoch nahmen wir davon Abstand, weil erstens Ch.`s, der geschäftlich unabkömmlich war,
Erfahrung fehlte, und zweitens fehlte uns damit auch ein geeigneteres Fahrzeug für ein
maximales Herankommen an den Berg. Obwohl Ri. ein oder zwei Wochen zuvor mit Ru., De. und
einem Bergführer den Cotopaxi erklommen hatte, beschlossen wir, wir wollten unbedingt was
unternehmen, den Cotopaxi zu packen. Ca.G. und ihr ecuadorianischer Freund, ein doch recht
erfahrener Bergführer wollten angeblich mit Rü.B. aufsteigen, das gab uns Sicherheit. So fuhren
Ri. und ich los, am späten Samstagvormittag, und sein VW-Bus schaffte, wenn auch unter
zeitweiligen Problemen, die Anfahrt bis kurz unter die 4800m hoch gelegenen Schutzhütte; der
Weg war trocken. Beim Aufstieg zur Hütte kam uns eine Gruppe entgegen und teilte uns mit,
dass auch Deutsche oben wären, zwei Männer, eine Frau: Alles wie vorhergesehen.
Nix da: Es waren Unbekannte.
Wir legten uns nieder, Schlaf fand ich nicht. Der Wind, ich kannte es nicht anders, heulte um das
Refugio.
Gegen 1:30 verließ eine Gruppe, drei bis fünf Mann stark, Ecuadorianer, die Hütte, wenig später
folgten zwei der drei Deutschen, die Frau blieb zurück. Zwanzig oder dreißig Minuten später
standen Ri. und ich draußen.
Barcelona, Las Ramblas, Dienstag, 17.09.1985, 20:00
Obwohl es schwer fällt, an einem lauen Spätsommerabend im menschendurchfluteten Barcelona
von der Bergeinsamkeit am Cotopaxi zu berichten, will ich dennoch versuchen, mich, so gut es
geht, hineinzuversetzen.
Wir begannen aufzusteigen, über Vulkanasche und Felsgrate, die Steigeisen hatten wir dieses
Mal nicht bereits an der Hütte angelegt. Ri. zeigte gleich zu Beginn, wie später mindestens noch
einmal, ein gutes Ortsgedächtnis: Wir fanden den idealen Einstieg in den Gletscher auf Anhieb.
Das war sehr wichtig. Die zweiköpfige deutsche, wie wir erfahren hatten dem Alpenverein
angehörende Gruppe hatte es nicht geschafft und irrte einiges oberhalb von uns am
Gletscherrand herum. Wir winkten sie mit den Stirnlampen in unsere Richtung. Die Lichter der
Ecuadorianer tanzten weit oberhalb von uns. Zunächst wollten wir unseren Augen nicht so recht
trauen, dann wurde es im Lauf der nächsten Stunde Gewissheit: Die Lichterkette wanderte nach
unten. Vermutlich hatten auch sie nicht den idealen Einstieg in den Gletscher gefunden und
waren in ein Gebiet geraten, dass von Spalten hoffnungslos zerrissen war.
Wieder einmal stiegen wir an, Stunde um Stunde. In der Passage, in der
wir mit den beiden Deutschen zusammen stiegen,
verfranzten wir uns. Ri. war bis zur Hälfte in eine Spalte
gesackt, ich suchte daraufhin, auf Knien rutschend und
mit dem Eispickel stochernd, nach einem Durchgang
durch das zugeschneite Spaltenlabyrinth. Es gab jedoch
keinen. Zur Rechten zog sich eine mächtige Eisschlucht
hin, mit glatten, senkrecht abfallenden Wänden, an die
15m tief. An ein Durchqueren war nicht zu denken,
schon das Absteigen an ihrem Rand war nicht ganz
einfach; der Eispickel als dritter Haltepunkt war
unabdingbar, und ich war dankbar, mit ihm einen guten Kauf gemacht
zu haben: Er biss sich im Eis regelrecht fest. Weiter unten konnte man
in die Schlucht einsteigen und sie durchqueren. Wir hatten eineinhalb
Stunden Zeit eingebüßt.
Die Sicht betrug zwar ein- bis zweihundert Meter, die Sonne konnte den Nebel jedoch nicht
durchdringen. Es wurde zunehmend kälter und windiger. Auf meiner Gletscherbrille fror
beständig eine Eisschicht von innen fest, weil sie durch meine Fernbrille zu weit vom wärmenden
Gesicht entfernt war. Ungenügende Sicht wirkt sich meist stark negativ auf die Lebensfreude
aus.
Der Wind war wieder einmal zum Sturm angewachsen. Im Sturm und Nebel gaben irgendwann
mal die beiden Deutschen auf, nach minutenlanger Diskussion; wir wollten sie zum Weitergehen
überreden. Zu diesem Zeitpunkt dürften wir fünf bis sechs Stunden unterwegs gewesen sein.
Wir waren endgültig allein am Berg, und stiegen weiter. Die Sicht nach vorn wurde zunehmend
schlechter, wir wussten nicht, wo die Yanasacha war, die charakteristische, mehr als 100m hohe
schwarze Wand etwa 200m unter dem Gipfel. Sie hätte schon längst auftauchen müssen.
Mein rechtes Auge begann zu schmerzen. Der Sturm blies mit solcher Macht, dass die Querung
einer kleinen, von Eisschollen übersäten Ebene Schwierigkeiten bereitete.
Nach sechs bis sieben Stunden deutete Ri. an, dass er nicht weiter wollte,
weil er den Gipfel nicht sah, nicht sah, wo es weiterging. Hätte ich
energisch widersprochen, wären wir wahrscheinlich weitergestiegen. Aber
ich war am Dollpunkt angelangt, von Wind und Kälte ausgelaugt, von
einem schmerzenden Auge geplagt, zögerte, und trat den Rückweg
keineswegs ungern an.
Weiter unten befielen mich noch Schmerzen in beiden Oberschenkeln, mehr unangenehm als
gefährlich. Sie waren, wie sich später erwies, eine direkte Folge des nicht ausgeglichenen
Flüssigkeits- bzw. Mineralsalzverlustes. Nachdem ich etwas getrunken hatte, waren sie wie
weggeblasen. Wie man so schön sagt. Auf dem Berg hatte ich nicht den geringsten Durst
verspürt.
Als wir wegfuhren, fetzte die Wolkendecke vorübergehend auf, gab vom
Nationalpark aus den Blick auf den Gipfel frei, und wir sahen wo wir
umgekehrt hatten: Oberhalb der Yanasacha, vielleicht 80m unterhalb des
Gipfels. Noch ein- bis anderthalb Stunden Plagerei hatten gefehlt. Wenig
und doch viel.
Barcelona, Restaurant Hotel „Cosmos“, 21:30
Bis zu meinem Abflug von Quito sind sicherlich noch erwähnenswerte Ereignisse geschehen, es
muss aber nicht alles festgehalten werden, vor allem wenn es mir sowieso nicht mehr einfällt.
Es fällt mir auch nicht auf Anhieb ein, wann und in welchem Zusammenhang ich das erste Mal
mit K. geschlafen habe. Auf Anhieb fällt mir nur das letzte Mal, in der Nacht vor meinem Abflug
ein, mit dem Schüttelfrost, und dem danach reichlich gezwungenen Abschied am Tag darauf am
Flughafen.
Jetzt nach dem Essen fällt mir das erste Mal wieder ein, es war direkt am Vorabend des
Schwefelquellentrips gewesen, der Reise zu den „Aguas hediontas“. Aber wie haben wir in ihr
Bett gefunden? War es ein Vorwand, und wenn ja, welcher? Ich weiß nicht mehr warum ich in
ihrem Bett lag, ich weiß nur noch, es geschah nicht in der Erwartung, mit ihr zu ficken, diese
Erwartung war Wochen zuvor bei ähnlichen Gelegenheiten bzw. „pettingartigen Vorgängen“,
mein Gott was für wulstiges Geschwafel, auf dem Sofa begraben worden. Es hatte sich jedoch
im Bett etwas entwickelt aus Wärme, dunkler Nähe, wegen zwei warmen Körpern, was weiß ich,
wegen was, auf jeden Fall recht natürlich, obschon, dieser Einwand sei erlaubt, sexualtechnisch
alles wenig einfallsreich ablief.
Aber warum habe ich im Bett, und nicht wie einige Male zuvor, auf dem Sofa geschlafen? Ich
weiß es nicht mehr. Ich muss K. danach fragen.
Am nächsten Morgen wollte sie mit Na. und La. an die kolumbianische Grenze, Hektik und
Tohuwabowa am frühen Morgen, im Endeffekt sagte K. La., dass ich noch mitfahr´, ich holte mit
K.`s Auto, noch halb besoffen, Zelt und notwendige Bekleidung, aus meiner Wohnung, halt
falsch, Zelt hatte ich am Vorabend (mit Aufbaudemonstration bei mir im Wohnzimmer) Na.
geliehen, anyway, wir fuhren zu viert, die drei Frauen und ich, los. Der anvisierte Berg an der
kolumbianischen Grenze war vollständig in Nebel, und ich glaube auch Regen gehüllt. Wir
nahmen von einer Besteigung Abstand und suchten noch am selben Tag die in der Nähe einsam
gelegenen „Aguas hediontas“, die „Stinkenden Wasser“ auf. Nach einiger Suche, der Boden der
Umgebung war entweder nass oder steil, schlugen wir in einem halbmeterhoch ummauerten
Geviert in der ansonst menschenleeren Umgebung unsere Zelte auf. Eine etwas unheimliche
Nacht, nahe an der kolumbianischen Grenze, rätselhafte Lichter blinkten unregelmäßig Hunderte
von Metern entfernt im Gebüsch auf. Schmuggler, Räuber? Vielleicht auch harmlose Viehhirten,
den Weg zu ihrer Hütte suchend. Na. und La. nahmen noch im Dunkeln ein Bad in den
stinkenden Wasser, die Luft stank in der Tat bestialisch nach Schwefelwasserstoff, und reizte,
besonders mich, zum Husten. Vermutlich war der MAK-Wert für H2S weit überschritten. K. und
ich verzogen uns ins Zelt, meine erste Nacht seit langem wieder unter der Zeltkuppel; ich fühlte
mich heimisch und wohl.
Am nächsten Morgen badeten wir alle vier, barbusig bzw. in Unterhosen,
nach einigen Zweifeln wegen zweier Indiofamilien, die am Sonntag zu dieser
Marienstätte gepilgert waren. An der Austrittstelle der Quelle kochte das
Wasser, alle Felsen und Steine waren von einer weißgelben Schwefelschicht
überzogen. Bei etwa 10 °C Außentemperatur lief ich einmal, nur mit nasser
Unterhose angetan, in das weiter entfernte Auto, ob es das war oder was
auch sonst, ich handelte mir bei diesem Trip so etwas wie eine Bronchitis
ein.
Zurück in Quito, abends unter der Dusche, knallharter Schüttelfrost, und ich wollte nicht allein
sein. Und vertraute mich K. nicht an; stolz wie immer. Anruf, Essen im „Bavaria“ abgesagt, ich
schlief bei und mit ihr, Wärme und Federbett taten mir, der ich zu Hause nur Indianerwolldecken
zum Schlafen besaß, ungeheuer wohl.
Am nächsten Vormittag flog ich nach Frankfurt. K. hatte mich zum Flughafen gefahren, zuvor
hatte ich von morgens sechs bis acht zu Hause meine Sachen gepackt, die Blumen raus auf die
Dachterrasse gestellt, mich von Ga. Br. verabschiedet.
Flug zurück nach, ich weiß nicht was, ich kenne mich in diesem Land am besten aus, ohne es
abgöttisch zu lieben, diesmal mit Lufthansa, in der Business Class, ein Upgrade, das man den
Begleitlehrern der Deutschland-Klassenfahrt eingeräumt hatte. Ein ruhiger Flug; ich weiß nur
noch: Mit Ch. an der Bar, und dazu zwei Waffenhändler. Und Husten.
Barcelona, Las Ramblas, Mittwoch, 18.09.1985, 14:00
Allmählich geht mir Barcelona auf die Nerven. Der Straßenlärm, die Hektik, die unablässlich
strömende Menschenmenge, auch die Reihen der Prostituierten öden mich an. Noch fünf
Stunden bis zur Abfahrt meines Zuges.
Zu der Deutschlandfahrt: Ohne besondere Probleme verlaufen; Disziplin und Pünktlichkeit der
Truppe verdienen die Note „überraschend“. Im Bus schliefen sie, in den Städten durchstreiften
sie, wann immer es möglich war, die Fußgänger-Einkaufszonen, in allen fünfzehn Städten, halt
ausgenommen Straßbourg und Zürich, da war jeweils gerade Sonntag.
Außer dass ich von Deutschland Dinge gesehen habe, die ich bisher nicht kannte, war die Fahrt
für mich in erster Linie ein finanzieller Erfolg. Berlin allerdings war eine Neppstadt, nicht nur
wegen eines schäbigen Bordellbesuchs. Zur Strukturierung der Fahrt: Man hätte sicherlich noch
das ein oder andere in puncto Attraktivität für diese Altersstufe arrangieren können, lebendiges
Theater zum Beispiel, oder ein moderner Circus, oder ein Rockkonzert, oder auch den Besuch
des deutschen Museums in München. Alles in allem bezeichne ich die Fahrt trotzdem als großen
Erfolg.
15:00
Seit ich wieder in Europa bin/oder weil Ferien sind/oder was weiß ich warum/sind meine
sexuellen Bedürfnisse im Vergleich zu Ecuador sehr stark angestiegen und haben die alten Werte
wieder erreicht. Gottseidank, obschon es natürlich eine Menge Zeit und Energie abzieht, die für
Anderes verwendet werden könnten. Aber Erörterungen darüber scheinen müßig zu sein.









Richard




Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
© strapp 2013
strapp.de durchsuchen:

Heidelberg, Donnerstag, 25.07.1985,
18:00
Der grippale Infekt, oder was immer es
sein mag, ist noch nicht vorüber, vielleicht
aber der Höhepunkt überschritten.
In den beiden vergangenen Tagen habe
ich lediglich ein einziges Brötchen zu mir
genommen, und meine augenblickliche
Schwäche dürfte auch darauf zurück zu
führen sein. Vielleicht helfen mir das
Jägerschnitzel und der viertel Liter „Côtes
du Rhône“ der „Zoogaststätte Garten“
über den Damm.
In einer Jugendherberge krank zu sein, ist
ekelhaft. Man kann sich nicht einmal
einen Tee bestellen, die Umgebung ist
laut, und meine Mitreisenden sind mir
auch keine Hilfe. Dies auch noch bei
herrlichem Wetter, wenn es von jungen
Mädchen verwirrend wimmelt, mit
freiwippenden Brüsten in weit
geschnittenen und auch weit
ausgeschnittenen Hemden. Es ist
wunderschön hier, an diesem warmen
Sommerabend, in dieser Gartenwirtschaft,
mit Kiesboden, mit alten Bäumen.
18:30
Ich begreife die Zusammenhänge nicht:
Wenn ich krank und unsicher bin, beiße
ich mir auf die Zunge, dass der Schweiß
ausbricht, klaut man mir, im Flugzeug,
den Schal, den ich gegen das Halsweh
bräuchte, in der Duschkabine meine
Haarshampoos, wo ich sie nur kurz habe
liegen lasse. Und dergleichen einiges
mehr: Was soll das? Evolutionsbiologisch
oder sonst irgendwie?
Berlin, Montag, 12.08.1985, 23:00
Dazu muss noch gesagt werden: Der Schal
wurde geklaut in San Juan/Puerto Rico,
geklaut bei +33 °C und 90 %
Luftfeuchtigkeit.
Mir würde vermutlich auch eine Badehose
am Nordpol geklaut werden.
Frankfurt, Freitag, 23.08.1985, 18:00
Dumme Frauen öden mich an, machen
mich krank. Es macht nicht mal Spaß, sie
zu ficken. Manchmal ganz selten, wenn
man fünf bis sechs Biere drin hat.
Stuttgart, Dienstag, 27.08.1985, 23:00
In einer Pizzeria, allein. Isoliert mit
Walkman, Kopfhörer, Mozarts “Don
Giovanni”.
Seit zwei Tagen in dem, was man alte
Heimat nennt, vermeintlich traute
Umgebung, oder wo man Bekannte oder
gar Freunde besitzt.
Die Umgebung macht mich gereizt bis
nervös, entschlusslos, antriebsschwach.
Aber vielleicht ist es nur das Tal nach dem
Jahr Schule, nach den fünf Wochen
Deutschlandfahrt mit einem Bus voller
Schüler.
Es scheint jedoch, dass die Zeit hier
stehen geblieben ist. Es scheint kein Tag
vergangen zu sein, dass ich diese
Umgebung verlassen habe. Nach den
zurückgelegten Kilometern scheint sie mir
noch öder, noch weniger
abwechslungsreich, schwerfällig.
Neuerungen, Änderungen weit weg. Weit
weg neue Gesichter und neue Körper, ein
interessantes Gespräch, ein interessantes
Gespräch, ein Flirt mit einem Mädchen
oder besser noch mit einer Frau. Was
habe ich mir versprochen? Ängstlichkeit
und Verkrampftheit sicher nicht. Ein
spritziges Cabaret, ein lustiger Film, ein
Konzert, vielleicht eine Oper? Nun ja,
nicht so ungeduldig, vielleicht findet sich
noch ein weibliches Wesen, das das
einmal oder mehrere Male mit mir teilt,
meinetwegen auch mehrere Wesen.
Es ist bedauerlich, dass ich in den
vergangenen Wochen und Monaten nicht
die Muße oder wenigstens Energie
besessen habe, Geschehenes unmittelbar
zu Papier zu bringen. Wesentlich wäre
gewesen, auf jeden Fall, die Cotopaxi-
Besteigung mit Ri.. Ich will versuchen,
den Vorgang zu rekonstruieren, wenn
auch schon geraume Zeit darüber
vergangen ist.
Vorgenommen hatten wir uns eigentlich
den Angriff auf den Illiniza Sur, den
zweiten Versuch. Jedoch nahmen wir
davon Abstand, weil erstens Ch.`s, der
geschäftlich unabkömmlich war,
Erfahrung fehlte, und zweitens fehlte uns
damit auch ein geeigneteres Fahrzeug für
ein maximales Herankommen an den
Berg. Obwohl Ri. ein oder zwei Wochen
zuvor mit Ru., De. und einem Bergführer
den Cotopaxi erklommen hatte,
beschlossen wir, wir wollten unbedingt
was unternehmen, den Cotopaxi zu
packen. Ca.G. und ihr ecuadorianischer
Freund, ein doch recht erfahrener
Bergführer wollten angeblich mit Rü.B.
aufsteigen, das gab uns Sicherheit. So
fuhren Ri. und ich los, am späten
Samstagvormittag, und sein VW-Bus
schaffte, wenn auch unter zeitweiligen
Problemen, die Anfahrt bis kurz unter die
4800m hoch gelegenen Schutzhütte; der
Weg war trocken. Beim Aufstieg zur Hütte
kam uns eine Gruppe entgegen und teilte
uns mit, dass auch Deutsche oben wären,
zwei Männer, eine Frau: Alles wie
vorhergesehen.
Nix da: Es waren Unbekannte.
Wir legten uns nieder, Schlaf fand ich
nicht. Der Wind, ich kannte es nicht
anders, heulte um das Refugio.
Gegen 1:30 verließ eine Gruppe, drei bis
fünf Mann stark, Ecuadorianer, die Hütte,
wenig später folgten zwei der drei
Deutschen, die Frau blieb zurück. Zwanzig
oder dreißig Minuten später standen Ri.
und ich draußen.
Barcelona, Las Ramblas, Dienstag,
17.09.1985, 20:00
Obwohl es schwer fällt, an einem lauen
Spätsommerabend im
menschendurchfluteten Barcelona von der
Bergeinsamkeit am Cotopaxi zu berichten,
will ich dennoch versuchen, mich, so gut
es geht, hineinzuversetzen.
Wir begannen aufzusteigen, über
Vulkanasche und Felsgrate, die Steigeisen
hatten wir dieses Mal nicht bereits an der
Hütte angelegt. Ri. zeigte gleich zu
Beginn, wie später mindestens noch
einmal, ein gutes Ortsgedächtnis: Wir
fanden den idealen Einstieg in
den Gletscher auf Anhieb. Das
war sehr wichtig. Die
zweiköpfige deutsche, wie wir
erfahren hatten dem
Alpenverein angehörende
Gruppe hatte es nicht geschafft
und irrte einiges oberhalb
von uns am Gletscherrand
herum. Wir winkten sie mit
den Stirnlampen in unsere
Richtung. Die Lichter der
Ecuadorianer tanzten weit
oberhalb von uns.
Zunächst wollten wir
unseren Augen nicht so
recht trauen, dann wurde
es im Lauf der nächsten
Stunde Gewissheit: Die Lichterkette
wanderte nach unten. Vermutlich hatten
auch sie nicht den idealen Einstieg in den
Gletscher gefunden und waren in ein
Gebiet geraten, dass von Spalten
hoffnungslos zerrissen war.
Wieder einmal stiegen wir an, Stunde um
Stunde. In der Passage, in der wir mit den
beiden Deutschen zusammen stiegen,
verfranzten wir uns. Ri. war bis zur Hälfte
in eine Spalte gesackt, ich suchte
daraufhin, auf Knien rutschend und mit
dem Eispickel stochernd, nach einem
Durchgang durch das zugeschneite
Spaltenlabyrinth. Es gab jedoch keinen.
Zur Rechten zog sich eine mächtige
Eisschlucht hin, mit glatten, senkrecht
abfallenden Wänden, an die 15m tief. An
ein Durchqueren war nicht zu denken,
schon das Absteigen an ihrem Rand war
nicht ganz einfach; der Eispickel als
dritter Haltepunkt war unabdingbar, und
ich war dankbar, mit ihm einen guten
Kauf gemacht zu haben: Er biss sich im
Eis regelrecht fest. Weiter unten konnte
man in die Schlucht einsteigen und sie
durchqueren. Wir hatten eineinhalb
Stunden Zeit eingebüßt.
Die Sicht betrug zwar ein- bis zweihundert
Meter, die Sonne konnte den Nebel jedoch
nicht durchdringen. Es wurde zunehmend
kälter und windiger. Auf meiner
Gletscherbrille fror beständig eine
Eisschicht von innen fest, weil sie durch
meine Fernbrille zu weit vom wärmenden
Gesicht entfernt war. Ungenügende Sicht
wirkt sich meist stark negativ auf die
Lebensfreude aus.
Der Wind war wieder einmal zum Sturm
angewachsen. Im Sturm und Nebel gaben
irgendwann mal die beiden Deutschen
auf, nach minutenlanger Diskussion; wir
wollten sie zum Weitergehen überreden.
Zu diesem Zeitpunkt dürften wir fünf bis
sechs Stunden unterwegs gewesen sein.
Wir waren endgültig allein am Berg, und
stiegen weiter. Die Sicht nach vorn wurde
zunehmend schlechter, wir wussten nicht,
wo die Yanasacha war, die
charakteristische, mehr als 100m hohe
schwarze Wand etwa 200m unter dem
Gipfel. Sie hätte schon längst auftauchen
müssen.
Mein rechtes Auge begann zu schmerzen.
Der Sturm blies mit solcher Macht, dass
die Querung einer kleinen, von
Eisschollen übersäten Ebene
Schwierigkeiten bereitete.
Nach sechs bis sieben
Stunden deutete Ri. an,
dass er nicht weiter wollte,
weil er den Gipfel nicht
sah, nicht sah, wo es weiterging. Hätte ich
energisch widersprochen, wären wir
wahrscheinlich weitergestiegen. Aber ich
war am Dollpunkt angelangt, von Wind
und Kälte ausgelaugt, von einem
schmerzenden Auge geplagt, zögerte, und
trat den Rückweg keineswegs ungern an.
Weiter unten befielen mich noch
Schmerzen in beiden Oberschenkeln,
mehr unangenehm als gefährlich. Sie
waren, wie sich später erwies, eine direkte
Folge des nicht ausgeglichenen
Flüssigkeits- bzw. Mineralsalzverlustes.
Nachdem ich etwas getrunken hatte,
waren sie wie weggeblasen. Wie man so
schön sagt. Auf dem Berg hatte ich nicht
den geringsten Durst verspürt.
Als wir wegfuhren, fetzte die Wolkendecke
vorübergehend auf, gab vom Nationalpark
aus den Blick auf den Gipfel frei, und wir
sahen wo wir umgekehrt
hatten: Oberhalb der
Yanasacha, vielleicht 80m
unterhalb des Gipfels.
Noch ein- bis anderthalb
Stunden Plagerei hatten gefehlt. Wenig
und doch viel.
Barcelona, Restaurant Hotel „Cosmos“,
21:30
Bis zu meinem Abflug von Quito sind
sicherlich noch erwähnenswerte
Ereignisse geschehen, es muss aber nicht
alles festgehalten werden, vor allem wenn
es mir sowieso nicht mehr einfällt.
Es fällt mir auch nicht auf Anhieb ein,
wann und in welchem Zusammenhang ich
das erste Mal mit K. geschlafen habe. Auf
Anhieb fällt mir nur das letzte Mal, in der
Nacht vor meinem Abflug ein, mit dem
Schüttelfrost, und dem danach reichlich
gezwungenen Abschied am Tag darauf am
Flughafen.
Jetzt nach dem Essen fällt mir das erste
Mal wieder ein, es war direkt am
Vorabend des Schwefelquellentrips
gewesen, der Reise zu den „Aguas
hediontas“. Aber wie haben wir in ihr Bett
gefunden? War es ein Vorwand, und wenn
ja, welcher? Ich weiß nicht mehr warum
ich in ihrem Bett lag, ich weiß nur noch, es
geschah nicht in der Erwartung, mit ihr zu
ficken, diese Erwartung war Wochen
zuvor bei ähnlichen Gelegenheiten bzw.
„pettingartigen Vorgängen“, mein Gott
was für wulstiges Geschwafel, auf dem
Sofa begraben worden. Es hatte sich
jedoch im Bett etwas entwickelt aus
Wärme, dunkler Nähe, wegen zwei
warmen Körpern, was weiß ich, wegen
was, auf jeden Fall recht natürlich,
obschon, dieser Einwand sei erlaubt,
sexualtechnisch alles wenig einfallsreich
ablief.
Aber warum habe ich im Bett, und nicht
wie einige Male zuvor, auf dem Sofa
geschlafen? Ich weiß es nicht mehr. Ich
muss K. danach fragen.
Am nächsten Morgen wollte sie mit Na.
und La. an die kolumbianische Grenze,
Hektik und Tohuwabowa am frühen
Morgen, im Endeffekt sagte K. La., dass
ich noch mitfahr´, ich holte mit K.`s Auto,
noch halb besoffen, Zelt und notwendige
Bekleidung, aus meiner Wohnung, halt
falsch, Zelt hatte ich am Vorabend (mit
Aufbaudemonstration bei mir im
Wohnzimmer) Na. geliehen, anyway, wir
fuhren zu viert, die drei Frauen und ich,
los. Der anvisierte Berg an der
kolumbianischen Grenze war vollständig
in Nebel, und ich glaube auch Regen
gehüllt. Wir nahmen von einer Besteigung
Abstand und suchten noch am selben Tag
die in der Nähe einsam gelegenen „Aguas
hediontas“, die „Stinkenden Wasser“ auf.
Nach einiger Suche, der Boden der
Umgebung war entweder nass oder steil,
schlugen wir in einem halbmeterhoch
ummauerten Geviert in der ansonst
menschenleeren Umgebung unsere Zelte
auf. Eine etwas unheimliche Nacht, nahe
an der kolumbianischen Grenze,
rätselhafte Lichter blinkten unregelmäßig
Hunderte von Metern entfernt im
Gebüsch auf. Schmuggler, Räuber?
Vielleicht auch harmlose Viehhirten, den
Weg zu ihrer Hütte suchend. Na. und La.
nahmen noch im Dunkeln ein Bad in den
stinkenden Wasser, die Luft stank in der
Tat bestialisch nach Schwefelwasserstoff,
und reizte, besonders mich, zum Husten.
Vermutlich war der MAK-Wert für H2S
weit überschritten. K. und ich verzogen
uns ins Zelt, meine erste Nacht seit
langem wieder unter der Zeltkuppel; ich
fühlte mich heimisch und wohl.
Am nächsten Morgen badeten wir alle
vier, barbusig bzw. in Unterhosen, nach
einigen Zweifeln wegen zweier
Indiofamilien, die am
Sonntag zu dieser
Marienstätte gepilgert
waren. An der
Austrittstelle der Quelle
kochte das Wasser, alle
Felsen und Steine waren
von einer weißgelben
Schwefelschicht überzogen.
Bei etwa 10 °C Außentemperatur lief ich
einmal, nur mit nasser Unterhose
angetan, in das weiter entfernte Auto, ob
es das war oder was auch sonst, ich
handelte mir bei diesem Trip so etwas wie
eine Bronchitis ein.
Zurück in Quito, abends unter der Dusche,
knallharter Schüttelfrost, und ich wollte
nicht allein sein. Und vertraute mich K.
nicht an; stolz wie immer. Anruf, Essen im
„Bavaria“ abgesagt, ich schlief bei und mit
ihr, Wärme und Federbett taten mir, der
ich zu Hause nur Indianerwolldecken zum
Schlafen besaß, ungeheuer wohl.
Am nächsten Vormittag flog ich nach
Frankfurt. K. hatte mich zum Flughafen
gefahren, zuvor hatte ich von morgens
sechs bis acht zu Hause meine Sachen
gepackt, die Blumen raus auf die
Dachterrasse gestellt, mich von Ga. Br.
verabschiedet.
Flug zurück nach, ich weiß nicht was, ich
kenne mich in diesem Land am besten
aus, ohne es abgöttisch zu lieben, diesmal
mit Lufthansa, in der Business Class, ein
Upgrade, das man den Begleitlehrern der
Deutschland-Klassenfahrt eingeräumt
hatte. Ein ruhiger Flug; ich weiß nur noch:
Mit Ch. an der Bar, und dazu zwei
Waffenhändler. Und Husten.
Barcelona, Las Ramblas, Mittwoch,
18.09.1985, 14:00
Allmählich geht mir Barcelona auf die
Nerven. Der Straßenlärm, die Hektik, die
unablässlich strömende Menschenmenge,
auch die Reihen der Prostituierten öden
mich an. Noch fünf Stunden bis zur
Abfahrt meines Zuges.
Zu der Deutschlandfahrt: Ohne besondere
Probleme verlaufen; Disziplin und
Pünktlichkeit der Truppe verdienen die
Note „überraschend“. Im Bus schliefen
sie, in den Städten durchstreiften sie,
wann immer es möglich war, die
Fußgänger-Einkaufszonen, in allen
fünfzehn Städten, halt ausgenommen
Straßbourg und Zürich, da war jeweils
gerade Sonntag.
Außer dass ich von Deutschland Dinge
gesehen habe, die ich bisher nicht kannte,
war die Fahrt für mich in erster Linie ein
finanzieller Erfolg. Berlin allerdings war
eine Neppstadt, nicht nur wegen eines
schäbigen Bordellbesuchs. Zur
Strukturierung der Fahrt: Man hätte
sicherlich noch das ein oder andere in
puncto Attraktivität für diese Altersstufe
arrangieren können, lebendiges Theater
zum Beispiel, oder ein moderner Circus,
oder ein Rockkonzert, oder auch den
Besuch des deutschen Museums in
München. Alles in allem bezeichne ich die
Fahrt trotzdem als großen Erfolg.
15:00
Seit ich wieder in Europa bin/oder weil
Ferien sind/oder was weiß ich
warum/sind meine sexuellen Bedürfnisse
im Vergleich zu Ecuador sehr stark
angestiegen und haben die alten Werte
wieder erreicht. Gottseidank, obschon es
natürlich eine Menge Zeit und Energie
abzieht, die für Anderes verwendet
werden könnten. Aber Erörterungen
darüber scheinen müßig zu sein.







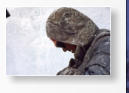

Richard




© strapp 2013
strapp.de durchsuchen:



























