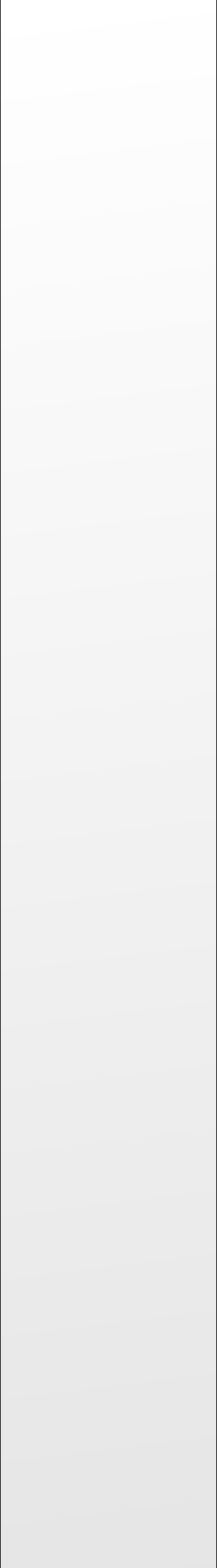




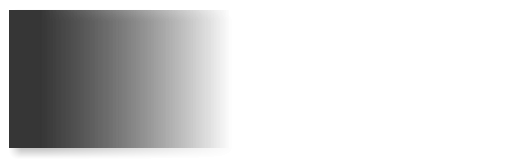
Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
strapp.de durchsuchen:
Meine Radikalisierung
Der Autor entdeckte mit Ende 40 seine Freude am Radfahren. Er dachte, er handele vernünftig und sogar zum
Wohle aller. Bis er merkte, wie die Autofahrer ihn behandeln: Als Verkehrshindernis
Von Henning Sußebach
Die Sache hatte lange vor dem Unfall begonnen. Bevor ich im Krankenhaus lag, das Knie operiert und
im Kopf diese eine Frage: War es mein Fehler gewesen, oder ist die Welt da draußen fehlerhaft?
Schon das klingt vermessen, ich weiß. Aber in diesem Artikel soll ja auch die Radikalisierung eines
Radfahrers nachgezeichnet werden. Es wird um körperliche Verletzungen und seelische Verletzlichkeit
gehen, um das Recht des Stärkeren und die Reizbarkeit des Schwächeren. Und letztlich um die Frage,
was wir als radikal wahrnehmen und was wir als normal begreifen.
Zunächst zu mir. Ich bin ein Mann von Ende 40. Meine Frau, unsere beiden Kinder und ich, wir leben in
einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, nahe der Hamburger Stadtgrenze. Wir wohnen in einem dieser
Einfamilienhäuser, die zuletzt in Verruf geraten sind, weil sie viel Fläche und Energie verbrauchen und
weil die Wege in die Stadt recht weit sind. In unserer Nachbarschaft gehört zu jedem Haus ein Carport.
Dass wir eine der wenigen Familien sind, die mit nur einem Auto auskommen, hat erst einmal wenig mit
ökologischem Ehrgeiz zu tun, sondern mit dem Glück, kurze Arbeitswege zu haben. Wir können beide
radeln, meine Frau ins nicht allzu entlegene Büro, ich zum Regionalbahnhof, zwei Kilometer entfernt.
Der alte Golf vor unserer Tür steht meist herum und kommt vor allem bei schlechtem Wetter, größeren
Einkäufen und Urlauben zum Einsatz.
Das hätte sich auch anders entwickeln können. Autos haben für mich durchaus einen Reiz. Bis heute
habe ich jede Folge der Streaming-Serie The Grand Tour gesehen, in der drei exzentrische Briten ihre
fast erotisch aufgeladene Liebe zu allerlei Sportwagen ausleben. Und vor einigen Jahren noch fuhr ich
einen in meinen Augen sehr eleganten Alfa Romeo. Leider führten die meisten Fahrten ihn und mich zur
Werkstatt. Der Wagen war ein Ärgernis, schon die Beschreibung "teures Vergnügen" gliche einem
Euphemismus. Ich verkaufte ihn. Wäre das Auto zuverlässiger gewesen, wäre ich heute womöglich
Mitglied eines Alfa-Fanclubs. Wer weiß.
Das erwähne ich aus der Überzeugung heraus, dass man nie nur aus eigenem Antrieb heraus der wird,
der man ist, der man gern wäre oder als der man gesehen wird. Es sind auch die Umstände, die uns
prägen. Mich hat ein Auto zum Radfahrer gemacht! Moral oder Ideologie spielten zunächst keine große
Rolle.
Mein Wandel begann im Frühjahr vor drei Jahren, nach einem langen Winter. Hin und wieder beschloss
ich morgens, nicht nur zum Regionalbahnhof zu radeln, sondern bis ins Hamburger Zentrum, in die
Redaktion. Rückblickend kommt es mir so vor, dass ich auch das nicht selbst entschied. Es geschah mir
eher; ich hatte das Gefühl, Licht und Luft könnten nicht schaden. Wer kennt das nicht.
Anfangs radelte ich nur bei gutem Wetter und auf Straßen, die mir heute grotesk gefährlich erscheinen,
nämlich auf den Routen, die mir als Autofahrer vertraut waren. Trotzdem löste sich jedes Mal ein
Versprechen ein, das ich mir vorab gar nicht gegeben hatte: Auf den ersten Kilometern, noch zwischen
Feldern, atmete ich tiefer durch als sonst. Und in der sich verdichtenden Stadt hatte ich spätestens am
Ufer der Außenalster, beim Einbiegen in dieses fantastische Panorama, den Eindruck, Teil einer
Postkarte zu werden.
Zwar nahm ich schon damals die Enge, den erratischen Verlauf und das abrupte Ende vieler Radwege
wahr und wartete an zig Ampeln, die für den Autoverkehr getaktet waren – dennoch war da ein
Glücksüberschuss: Im Frühjahr roch ich den Raps, im Sommer die Linden, im Herbst die Nässe des
Bodens. Das Wetter war in aller Regel besser als auf den dräuenden Symbolen der Vorhersage-Apps.
Dazu war ich auf dem Sattel nochmals ein anderer Mensch als zu Hause oder im Büro, nicht Vater oder
Kollege oder Nachbar, sondern ein Wesen aus Fleisch und Blut und Muskeln und Puls (was auch ein
Nachteil ist, von dem noch die Rede sein wird). Ich blieb schlank oder wurde wenigstens langsamer
dick. Die freigestrampelten Endorphine trugen mich durch den Tag. Abends konnte ich mir ein Bierchen
gönnen. Nachts schlief ich gut.
So fuhr ich öfter und öfter, nie jeden Tag, bis heute nicht, denn die Tour dauert eine Stunde, so viel Zeit
hat man nicht immer. Einige Monate benutzte ich das alte Rad, mit dem ich zum Bahnhof gejuckelt war.
Dann beschloss ich, mir ein neues zu kaufen. Marke Schindelhauer, Modell Siegfried.
Wer hier stutzt und sich fragt, ob so eine Erwähnung nicht Schleichwerbung ist, wer an dieser Stelle also
eine erste Entfremdung zum Autor spürt ... den möchte ich von der anderen Seite des kleinen
Befremdlichkeits-Bruchs zurückfragen: Warum kam der Gedanke an Schleichwerbung nicht schon bei
der Erwähnung der Autos in diesem Artikel?
Ich glaube, das hat mit unserer Alltagskultur zu tun. Damit, was wir als gewöhnlich verstehen. Es ist
normal, zu erzählen, was für ein Auto man fährt. Nicht aber, welches Fahrrad. Woran liegt das?
Obwohl das Auto das wohl wichtigste deutsche Wirtschaftsgut ist, millionenfach produziert, beworben,
verkauft, nehmen wir es mehrheitlich noch als etwas anderes wahr: als Objekt zur Selbstbeschreibung.
Wer sich einen Mercedes kauft, sagt damit etwas über sich und seine Einstellung zum Leben, zur
Mobilität, zum Konsum. Das tut ebenso, wer einen Volvo fährt. Auch ein Dacia ist ein Statement. Jede
Kaufentscheidung ist mit einer Selbsteinordnung und einer Auskunft an die anderen verbunden.
Nun wollte ich ein Fahrrad für mich als Fortbewegungsmittel in den Rang des Autos rücken. Folglich
wählte ich es – typisch Mann in mittleren Jahren – nach ähnlichen Kriterien aus. Auch als Radfahrer hat
man längst die Wahl zwischen zig Alternativen, die wieder Aussagen beinhalten: Rennrad, Klapprad
oder E-Bike? Stahl, Aluminium oder Carbon? Mein neues Rad war keine neun Kilogramm schwer, hatte
einen Rahmen aus nacktem Alu, einen Carbon-Riemen statt Kette, gute Bremsen, nur einen einzigen
Gang und kostete trotzdem viel. Kein Verzichtsgefährt, eher ein Silberpfeil, made in Germany. Wie ein
Autokäufer erlag auch ich dem technoiden Kitzel einer Maschine, in diesem Fall eines Modells, das in
seiner Reduktion alles ausstrahlte, was ich am Radfahren zu schätzen gelernt hatte: mit wie wenig
Materialaufwand man seine Reichweite vergrößert! Wie perfekt Mensch und Maschine in ihren
Proportionen harmonieren! Wie mechanisch fein und doch nachvollziehbar alles funktioniert! Aus diesen
Gründen hat mein Kollege Maximilian Probst das Radfahren einmal als "die letzte humane Technik"
beschrieben.
Mein Rad war so schlicht, dass ich darauf fast zwangsläufig Turnschuhe, Jeans, T-Shirt und Helm
tragen musste, kein Trikot in Signalfarben. So weit war ich gedanklich gekommen auf meinen ersten
Fahrten: Ich wollte nicht aussehen wie eine radelnde Wurstpelle oder ein rechthaberischer Radritter. Ich
wollte flink und lässig sein wie ein Fahrradkurier.
Wie jeder Besitzer eines neuen Gefährts glaubte auch ich auf dem neuen Rad anfangs zu schweben,
was nicht nur an den perfekten Kugellagern lag. Ich fuhr im Schnitt zwei, drei Stundenkilometer
schneller als zuvor und war auf eine Art enthusiastisch, die ich mir heute unter anderem mit Nostalgie
erkläre: Nach dem Abitur hatte ich mich schon einmal auf ein Rad gesetzt und war losgefahren, durch
das soeben demokratisierte Osteuropa bis an die Grenze zur Sowjetunion. Später noch über die Alpen,
Flüsse entlang, durch allerlei Länder. Damals ließ ich auf dem Rad die Kindheit hinter mir. Es war ein
Freiheitsvehikel.
Nun, mit dem Kauf des neuen Rades, hatte ich eine Entscheidung gefällt in einer Lebensphase, in der
man sonst eher wenige Entschlüsse fasst. Hochzeit, Kinder, Wahl des Wohnorts – in den Vierzigern
liegt das einige Zeit zurück. Aber sich ein Herz fassen? Wenigstens ein neues Hobby erschließen? Das
macht Spaß und Männer in der Midlifecrisis zu schwer berechenbaren Wesen.
Im Gegensatz zu einer Affäre oder dem Kauf eines Sportwagens erschien mir meine Wahl rational: Als
Radfahrer würde ich gesund leben und niemandem schaden. Zum Klimawandel würde ich auch etwas
weniger beitragen. Es fühlte sich alles sehr gut und groß an. Leider war das den anderen auf der Straße
nicht klar.
Je öfter ich nun aufbrach, desto häufiger hatte ich den Eindruck, dass ich für Autofahrer Luft war.
Radelte ich morgens fröhlich los, durch die Vorortstraßen meiner Nachbarschaft, die gegenüberliegende
Fahrbahn zugeparkt, meine Spur frei – zog jedes zweite mir entgegenkommende Auto kompromisslos
durch. Ich bremste dann und blieb entweder stehen oder quetschte mich an Straßenränder, holperte
durch Schlaglöcher, rumpelte über Gullis. Einige Autofahrer bekamen davon nichts mit, anderen war es
offenbar egal. Mich ärgerte das. Hätte ich in einem Auto gesessen, wären die entgegenkommenden
Wagen doch stehen geblieben! Diese Missachtung tat mir weh. Dass ich es da mit einem uralten
Menschheitsgefühl zu tun hatte, erklärte mir ein belesener Bekannter: Schon vor 2500 Jahren hatte
Sophokles seinen Ödipus die gleiche Erniedrigung erfahren lassen – mit den bekannten Folgen. In
Sophokles’ Drama ist der tragische Held als Wanderer unterwegs, als ihm auf schmalem Pfad ein
"rossbespannter Wagen" begegnet. Der Kutscher beharrt von oben herab auf Durchfahrt, der Passagier
im Wagen gibt sich ebenso arrogant. Da erschlägt Ödipus rasend vor Wut zunächst den Kutscher und
dann den Fahrgast, von dem er nicht weiß, dass der sein Vater ist.
Es gilt § 6 der Straßenverkehrsordnung (StVO): Wartepflichtig ist der, auf dessen Seite die Fahrbahn
blockiert ist. Sollte die verbliebene Spur breit genug sein, dass zwei Fahrzeuge passieren können,
müssen beide ihre Geschwindigkeit anpassen. Breit genug ist die Spur aber nur dann, wenn der
Radfahrer nicht gezwungen wird, seinen Sicherheitsabstand zum rechten Fahrbahnrand aufzugeben,
und das ihm entgegenkommende Auto dazu einen Meter auf Distanz bleiben kann. Das ist selten der
Fall – und vorab eigentlich nie sicher abzuschätzen.
Heute würden an der antiken Engstelle vermutlich Verkehrsschilder stehen, jedenfalls gibt es Regeln.
Sie lesen sich fußnotenkompliziert und sind letztlich doch einfach. Auf seiner Straßenseite hat der
Radfahrer Vorfahrt. Doch das juckt die Kutscher kaum.
Gemeinhin gelten wir Deutschen ja als regelkonform, sogar regelgierig. Auf dem Rad musste ich
allerdings lernen, dass draußen ein "Gesetz der Straße" gilt, ungeschrieben und omnipräsent. Es ist der
Gewohnheitsglaube, dass Straßen den Autos gehören. Und dass 50 km/h Normalgeschwindigkeit sind.
Deshalb kommt sich ein Autofahrer in einer 30er-Zone ohnehin langsam vor ... und noch langsamer,
wenn ein Radfahrer mit 24 km/h vorwegfährt. Da fährt er dicht auf, um seine Ungeduld kundzutun. Da
quetscht er sich schnell vorbei, sobald sich die kleinste Lücke auftut. Da vergisst er beim Öffnen der
Fahrertür den Schulterblick.
Nicht alles ist Absicht, einiges geschieht unbewusst, oft handelt es sich nur um Mikroaggressionen, wie
Sozialpsychologen wiederkehrende kleine Übergriffe nennen. Es mag kaum der Rede wert sein, dass
nahezu alle Besitzer eines Geländewagens, der zu lang oder zu breit für einen Parkplatz ist, den
Überhang ihres Gefährts nicht auf die Straße ragen lassen, sondern auf den Geh- und Radweg. In der
Summe können solche Mikroaggressionen makro sein: Irgendwann kommt die alte Dame mit dem
Rollator nicht mehr durch, und auch ein Fahrradlenker ist zu breit für den verbliebenen Raum.
Ich kann nicht genau sagen, ob mir all das auf meinem neuen Rad wirklich öfter widerfuhr, jedenfalls
nahm ich es häufiger wahr. Aber lag das an mir? Ich wollte mich nur mit der gleichen
Selbstverständlichkeit durch die Stadt bewegen wie die anderen. Das war zu viel verlangt.
Zwar wird mittlerweile über autofreie Innenstädte und Tempolimits diskutiert, aber die Wahrheit lautet,
frei nach James Brown: This is a car’s world. Und das bis in die hintersten Winkel unserer
Gepflogenheiten und Gehirne. Entfernungen machen wir uns in "Autostunden" begreiflich. Sprachlich
geben wir im Berufsleben "Gas" und schalten im Urlaub "einen Gang runter". In Zeitungen werden
Unfallmeldungen zu schuldlos überrollten Passanten mit Überschriften wie "Kind gerät unter Auto" oder
"Radfahrerin stürzt in abbiegenden Lkw" versehen. Stirbt jemand ohne eigenes Zutun, fehlt nicht der
Hinweis, das Opfer habe leider keinen Helm getragen. Irgendwie doch selbst schuld.
Stand je in einer Unfallmeldung, ein Auto, dem die Vorfahrt genommen wurde, sei leider "unauffällig
lackiert" gewesen? Nein, so denken wir nicht. Drei Viertel aller Neuwagen in Deutschland sind
nachtschwarz, regengrau oder nebelweiß – während Fußgänger und Radfahrer sich mit Reflektoren
ausstaffieren und bepolstern, sobald sie im Dunklen das Haus verlassen. Als gingen sie einem
Extremsport nach. Dabei wollen sie nur zur Schule, zur Arbeit oder kurz mit dem Hund raus, der
inzwischen auch Leuchtweste trägt.
Einmal, es war Winter, postete ich auf Twitter ein Foto. Es zeigte eine vom Schnee geräumte Straße,
daneben einen vereisten Fuß- und Radweg. Unter das Bild schrieb ich das Wort "Prioritäten". Eine
Antwort, die ich erhielt: "Dann fahrt mit dem ÖPNV! Wenn bei solcher Witterung jemand mit einem
Zweirad vor mir wegrutscht werde ich statt zu bremsen nochmal schön das Lenkrad einschlagen und
den Kopf anvisieren. Fahrräder und alles unter 40 PS haben nichts im Straßenverkehr zu suchen!!!!!"
Zivilisierter im Ton, aber ähnlich unnachgiebig in der Sache gab sich einmal ein Herr, der für seinen
Geschmack nicht schnell genug an mir vorbeikam, dann aber Zeit hatte, ein Fenster herunterzulassen
und zu rufen: "Sie wissen schon, dass Sie ein Verkehrshindernis darstellen!?" Für die Information, dass
wir beide Verkehrsteilnehmer sind, hatte er dann schon wieder keine Zeit mehr.
Warum einige Menschen so ticken, hat mir ein Sozialgeograf erklärt; ein Mann, der erforscht, wie
Gesellschaften ihre Umgebung prägen – und die Umgebung dann wieder das Handeln der Gesellschaft
bestimmt. Deutschland, sagte er, sei über Jahrzehnte ausschließlich für den erwerbstätigen Teil der
Bevölkerung gestaltet worden. Früher waren das Berufstätige mit Auto, meistens Männer. Alle Aspekte,
die entscheidend seien fürs Bruttosozialprodukt, hätten Vorrang gehabt bei der materiellen Gestaltung
der Welt. Kinder, nach ökonomischen Kriterien unproduktiv, werden deshalb "in umzäunte Bereiche
abgesondert", Alte suchen sich mühsam ihre Wege, Frauen hasten durch düstere Unterführungen. Wir
sind ein Land der Staubsaugervertreter, bis heute: In der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, die der Politik vorschlägt, wie breit ein Radweg sein darf und wie lange Fußgänger auf
Grün warten müssen, sitzen zu über 80 Prozent Männer. Einige von ihnen arbeiten hauptberuflich bei
Straßenbaufirmen. Zwar hat eine neue Stadtplaner-Generation die Versäumnisse erkannt. Aber Straßen
lassen sich schlecht radikal umwidmen, allenfalls hier und da mal hundert Meter. Zu alldem Beton
kommt noch das Beharren vieler. Nie waren in Deutschland mehr Autos zugelassen als heute.
All das nahm ich jetzt klarer wahr. Als Störfaktor für den "Verkehrsfluss" nach Kfz-Kriterien schaute ich
selbst verstört auf mein bis dahin vertrautes Umfeld. Ähnlich wie jemand, der kein Fleisch mehr essen
will und bemerkt, wie fleischbeladen unsere Speisekarten sind.
Gewohntes erschien mir nun absonderlich: Wären Zeitreisen möglich, dachte ich, und man würde die
Autos der Jetztzeit im Jahr 1950 abstellen, die Menschen wären erschrocken in Anbetracht der
grimmigen Kühlergrillgesichter, die das Lächeln des VW Käfers verdrängt haben. Vermutlich würden
sich die Eltern von damals auch beschweren, dass Kinder auf den Straßen von heute nicht spielen
könnten. Dass wir uns indes damit abfinden, unseren Töchtern und Söhnen eine Art Todesangst vor
Bordsteinkanten anzuerziehen, sobald sie laufen lernen, liegt daran, dass sich die Veränderung des
Verkehrs schleichend statt schlagartig vollzog. Wenn ein neues Automodell größer ist als das alte, ist in
der Werbung immer von "Evolution" die Rede, als vollziehe sich da ein natürlicher Prozess. Dabei ist es
Irrsinn. Zahllose Studien belegen es: Straßenverkehr stellt hierzulande die größte Quelle für
Lärmbelästigung dar. Wenn Kinder an einer dicht befahrenen Straße wohnen, bewegen sie sich seltener
und werden darüber krank. Die meisten "Verkehrsfolgekosten" für die Allgemeinheit verursacht das
Auto. Diese Aufzählung könnte endlos weitergehen.
Meine Entscheidung, mehr Rad zu fahren, war also unbestreitbar vernünftig. So, wie es Sinn ergibt, auf
Fleisch zu verzichten. Aber mein Entschluss war nicht üblich in dem Sinne, dass die Mehrheit so
handelt. Man gerät an den Rand. Und dass Radfahrer in Deutschland eine Randerscheinung sind,
bekam ich zu spüren.
Nur kurz drei Klassiker, der Anschauung wegen:
Klassiker 1: Gut gemeint, schlecht gemacht
Laut Gesetzeslage gilt der Überholabstand von 1,50 Metern innerorts auch an Schutzstreifen.
Es gibt Radwege. Und es gibt "Radfahrschutzstreifen" am rechten Fahrbahnrand, ein auf die Straße
gestricheltes Nichts in Autotür-Breite, für jede Kommune die billigste Lösung, scheinbar etwas für Radler
zu tun. Das Resultat gleicht einer Todesfalle: Fährt man mittig auf dem Schutzstreifen, bewegt man sich
stets in Tür-Reichweite der parkenden Autos. Fährt man weiter links, schneiden einen viele der
überholenden Wagen, deren Fahrer ja annehmen, bis zum Strichel-Strich gehöre die Straße ihnen. Das
tut sie nicht, aber wer würde ohne Knautschzone darauf bestehen? Also bleibt man als Radfahrer
rechts, lauscht nach hinten, blickt nach vorne und scannt jedes parkende Auto auf die Möglichkeit einer
sich unversehens öffnenden Tür hin, auf jedwede Spur von Leben, auf Fahrersilhouetten,
heruntergelassene Fenster, aufleuchtende Rücklichter, sich aus- oder einklappende Rückspiegel. Wer
sich als Autofahrer schon darüber ärgert, dass der Vordermann bei Grün zu spät losfährt, kann gerne
mal tauschen.
Klassiker 2: Unwissen vor Recht
Ist auf einem Fußweg ein weißes Schild zu sehen, darauf die Silhouette eines Fahrrads und das Wort
"frei" – dann fühlen sich vor allem ältere Autofahrer berufen, Radler von der Straße zu hupen, sie zu
bedrängen und zu brüllen: "Da ist ein Radweg, du Idiot, benutz doch den!" In Wahrheit ist es Nötigung.
Denn das weiße Schild signalisiert nur: Dies ist ein Gehweg, auf dem auch Radler fahren dürfen. Wenn
sie wollen.
Die StVO unterscheidet grob gesagt zwischen Radwegen mit Benutzungspflicht (blaue Schilder) und
solchen ohne (weiße Schilder). Bei Letzteren liegt die Entscheidung beim Radfahrer, ob er auf der
Straße oder auf dem Fußgängerweg fährt. Missverständnisse sind dann hier wie dort wahrscheinlich.
Ein wirklich "benutzungspflichtiger" Radweg befindet sich nur da, wo ein weißes Fahrrad auf blauem
Grund zu sehen ist. Aber wer weiß das schon? Was gilt und was nicht, das entscheiden laut Gesetz der
Straße ja die Autofahrer, nach meinem Eindruck vor allem die angejahrten, die vor 40 Jahren in der
Fahrschule waren und denen man ihren Irrglauben nicht ausreden kann. Denn nach ihrem
Umerziehungs-Überholmanöver sind sie auf und davon, kopfschüttelnd.
Klassiker 3: Parabelflug
Ein Auto kommt aus einer Einfahrt, einer Seitenstraße ... und hört nicht auf zu rollen, rückt näher und
näher. Für den Fahrer mag’s sich "souverän" oder "sportlich" anfühlen, wenn es ihm gelingt, den Radler
vorbeizulassen, ohne eine Sekunde zu viel zu verschenken. Als gehe es nicht darum, auf eine Straße
einzubiegen, sondern um einen über Jahre vorausberechneten Parabelflug durchs Weltall, den man
leider nicht mehr unterbrechen kann. Dem Autofahrer erscheint sein Weiterrollen also smart und dazu
undramatisch, zumal er den Radler ja sieht (falls er ihn denn sieht).
Der Radler erkennt aber durch die von außen spiegelnden Scheiben des Autos den Fahrer nicht und
muss nach allerlei Erfahrungen befürchten, gar nicht wahrgenommen worden zu sein. Vorsichtshalber
wird er langsamer, wodurch die Überschlagsrechnung des anrollenden Autofahrers endgültig nicht mehr
aufgeht ... und der Gas gibt, weil er annimmt, der Radfahrer bleibe für ihn stehen. Das führt dann
wirklich zu Parabelflügen.
Wenn ich nun schreibe, dass mir trotz alldem lange nichts passierte, klingt das so, als hätte ich bis
hierhin maßlos übertrieben. Allerdings heißt "nichts passiert" nur: Ich hatte das Glück, kein Pech zu
haben. Es bedeutet, regelmäßig geschnitten und von Rechtsabbiegern übersehen worden zu sein,
scharf gebremst und aufmerksamen Autofahrern in pantomimischen Ausdruckstänzen gedankt zu
haben, dass sie sich an Regeln hielten. "Nichts passiert" hieß auch, abwägend kleine Risiken
eingegangen zu sein (in Schlaglöcher zu steuern), um größere Risiken (Zusammenprall) zu vermeiden.
Es hieß, in Nebenstraßen auszuweichen und längere Strecken in Kauf zu nehmen. Und schließlich,
morgens nicht loszufahren, wann es meinen Bedürfnissen entsprochen hätte, sondern bis mindestens
acht Uhr zu warten. Dann wurden die Straßen leerer, waren weniger Eilige und Dienstwagendringliche
unterwegs. Ich lernte die Stadt neu zu lesen, als Habitat, in dem ich nicht heimisch war. Eine Antilope
wagt sich auch erst ans Wasserloch, wenn die Löwen verschwunden sind.
Dass all das als "nichts passiert" erscheint, ist ein Teil des Problems.
weiterlesen

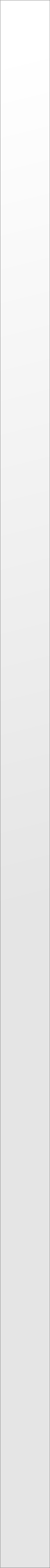




Meine Radikalisierung
Der Autor entdeckte mit Ende 40 seine
Freude am Radfahren. Er dachte, er handele
vernünftig und sogar zum Wohle aller. Bis
er merkte, wie die Autofahrer ihn behandeln:
Als Verkehrshindernis
Von Henning Sußebach
Die Sache hatte lange vor dem Unfall
begonnen. Bevor ich im Krankenhaus lag, das
Knie operiert und im Kopf diese eine Frage:
War es mein Fehler gewesen, oder ist die Welt
da draußen fehlerhaft?
Schon das klingt vermessen, ich weiß. Aber in
diesem Artikel soll ja auch die Radikalisierung
eines Radfahrers nachgezeichnet werden. Es
wird um körperliche Verletzungen und
seelische Verletzlichkeit gehen, um das Recht
des Stärkeren und die Reizbarkeit des
Schwächeren. Und letztlich um die Frage, was
wir als radikal wahrnehmen und was wir als
normal begreifen.
Zunächst zu mir. Ich bin ein Mann von Ende
40. Meine Frau, unsere beiden Kinder und ich,
wir leben in einer Kleinstadt in Schleswig-
Holstein, nahe der Hamburger Stadtgrenze. Wir
wohnen in einem dieser Einfamilienhäuser, die
zuletzt in Verruf geraten sind, weil sie viel
Fläche und Energie verbrauchen und weil die
Wege in die Stadt recht weit sind. In unserer
Nachbarschaft gehört zu jedem Haus ein
Carport. Dass wir eine der wenigen Familien
sind, die mit nur einem Auto auskommen, hat
erst einmal wenig mit ökologischem Ehrgeiz zu
tun, sondern mit dem Glück, kurze Arbeitswege
zu haben. Wir können beide radeln, meine Frau
ins nicht allzu entlegene Büro, ich zum
Regionalbahnhof, zwei Kilometer entfernt. Der
alte Golf vor unserer Tür steht meist herum und
kommt vor allem bei schlechtem Wetter,
größeren Einkäufen und Urlauben zum Einsatz.
Das hätte sich auch anders entwickeln können.
Autos haben für mich durchaus einen Reiz. Bis
heute habe ich jede Folge der Streaming-Serie
The Grand Tour gesehen, in der drei
exzentrische Briten ihre fast erotisch
aufgeladene Liebe zu allerlei Sportwagen
ausleben. Und vor einigen Jahren noch fuhr ich
einen in meinen Augen sehr eleganten Alfa
Romeo. Leider führten die meisten Fahrten ihn
und mich zur Werkstatt. Der Wagen war ein
Ärgernis, schon die Beschreibung "teures
Vergnügen" gliche einem Euphemismus. Ich
verkaufte ihn. Wäre das Auto zuverlässiger
gewesen, wäre ich heute womöglich Mitglied
eines Alfa-Fanclubs. Wer weiß.
Das erwähne ich aus der Überzeugung heraus,
dass man nie nur aus eigenem Antrieb heraus
der wird, der man ist, der man gern wäre oder
als der man gesehen wird. Es sind auch die
Umstände, die uns prägen. Mich hat ein Auto
zum Radfahrer gemacht! Moral oder Ideologie
spielten zunächst keine große Rolle.
Mein Wandel begann im Frühjahr vor drei
Jahren, nach einem langen Winter. Hin und
wieder beschloss ich morgens, nicht nur zum
Regionalbahnhof zu radeln, sondern bis ins
Hamburger Zentrum, in die Redaktion.
Rückblickend kommt es mir so vor, dass ich
auch das nicht selbst entschied. Es geschah
mir eher; ich hatte das Gefühl, Licht und Luft
könnten nicht schaden. Wer kennt das nicht.
Anfangs radelte ich nur bei gutem Wetter und
auf Straßen, die mir heute grotesk gefährlich
erscheinen, nämlich auf den Routen, die mir als
Autofahrer vertraut waren. Trotzdem löste sich
jedes Mal ein Versprechen ein, das ich mir
vorab gar nicht gegeben hatte: Auf den ersten
Kilometern, noch zwischen Feldern, atmete ich
tiefer durch als sonst. Und in der sich
verdichtenden Stadt hatte ich spätestens am
Ufer der Außenalster, beim Einbiegen in dieses
fantastische Panorama, den Eindruck, Teil
einer Postkarte zu werden.
Zwar nahm ich schon damals die Enge, den
erratischen Verlauf und das abrupte Ende
vieler Radwege wahr und wartete an zig
Ampeln, die für den Autoverkehr getaktet
waren – dennoch war da ein
Glücksüberschuss: Im Frühjahr roch ich den
Raps, im Sommer die Linden, im Herbst die
Nässe des Bodens. Das Wetter war in aller
Regel besser als auf den dräuenden Symbolen
der Vorhersage-Apps. Dazu war ich auf dem
Sattel nochmals ein anderer Mensch als zu
Hause oder im Büro, nicht Vater oder Kollege
oder Nachbar, sondern ein Wesen aus Fleisch
und Blut und Muskeln und Puls (was auch ein
Nachteil ist, von dem noch die Rede sein wird).
Ich blieb schlank oder wurde wenigstens
langsamer dick. Die freigestrampelten
Endorphine trugen mich durch den Tag.
Abends konnte ich mir ein Bierchen gönnen.
Nachts schlief ich gut.
So fuhr ich öfter und öfter, nie jeden Tag, bis
heute nicht, denn die Tour dauert eine Stunde,
so viel Zeit hat man nicht immer. Einige Monate
benutzte ich das alte Rad, mit dem ich zum
Bahnhof gejuckelt war. Dann beschloss ich, mir
ein neues zu kaufen. Marke Schindelhauer,
Modell Siegfried.
Wer hier stutzt und sich fragt, ob so eine
Erwähnung nicht Schleichwerbung ist, wer an
dieser Stelle also eine erste Entfremdung zum
Autor spürt ... den möchte ich von der anderen
Seite des kleinen Befremdlichkeits-Bruchs
zurückfragen: Warum kam der Gedanke an
Schleichwerbung nicht schon bei der
Erwähnung der Autos in diesem Artikel?
Ich glaube, das hat mit unserer Alltagskultur zu
tun. Damit, was wir als gewöhnlich verstehen.
Es ist normal, zu erzählen, was für ein Auto
man fährt. Nicht aber, welches Fahrrad. Woran
liegt das?
Obwohl das Auto das wohl wichtigste deutsche
Wirtschaftsgut ist, millionenfach produziert,
beworben, verkauft, nehmen wir es
mehrheitlich noch als etwas anderes wahr: als
Objekt zur Selbstbeschreibung. Wer sich einen
Mercedes kauft, sagt damit etwas über sich
und seine Einstellung zum Leben, zur Mobilität,
zum Konsum. Das tut ebenso, wer einen Volvo
fährt. Auch ein Dacia ist ein Statement. Jede
Kaufentscheidung ist mit einer
Selbsteinordnung und einer Auskunft an die
anderen verbunden.
Nun wollte ich ein Fahrrad für mich als
Fortbewegungsmittel in den Rang des Autos
rücken. Folglich wählte ich es – typisch Mann in
mittleren Jahren – nach ähnlichen Kriterien
aus. Auch als Radfahrer hat man längst die
Wahl zwischen zig Alternativen, die wieder
Aussagen beinhalten: Rennrad, Klapprad oder
E-Bike? Stahl, Aluminium oder Carbon? Mein
neues Rad war keine neun Kilogramm schwer,
hatte einen Rahmen aus nacktem Alu, einen
Carbon-Riemen statt Kette, gute Bremsen, nur
einen einzigen Gang und kostete trotzdem viel.
Kein Verzichtsgefährt, eher ein Silberpfeil,
made in Germany. Wie ein Autokäufer erlag
auch ich dem technoiden Kitzel einer
Maschine, in diesem Fall eines Modells, das in
seiner Reduktion alles ausstrahlte, was ich am
Radfahren zu schätzen gelernt hatte: mit wie
wenig Materialaufwand man seine Reichweite
vergrößert! Wie perfekt Mensch und Maschine
in ihren Proportionen harmonieren! Wie
mechanisch fein und doch nachvollziehbar
alles funktioniert! Aus diesen Gründen hat mein
Kollege Maximilian Probst das Radfahren
einmal als "die letzte humane Technik"
beschrieben.
Mein Rad war so schlicht, dass ich darauf fast
zwangsläufig Turnschuhe, Jeans, T-Shirt und
Helm tragen musste, kein Trikot in
Signalfarben. So weit war ich gedanklich
gekommen auf meinen ersten Fahrten: Ich
wollte nicht aussehen wie eine radelnde
Wurstpelle oder ein rechthaberischer Radritter.
Ich wollte flink und lässig sein wie ein
Fahrradkurier.
Wie jeder Besitzer eines neuen Gefährts
glaubte auch ich auf dem neuen Rad anfangs
zu schweben, was nicht nur an den perfekten
Kugellagern lag. Ich fuhr im Schnitt zwei, drei
Stundenkilometer schneller als zuvor und war
auf eine Art enthusiastisch, die ich mir heute
unter anderem mit Nostalgie erkläre: Nach dem
Abitur hatte ich mich schon einmal auf ein Rad
gesetzt und war losgefahren, durch das soeben
demokratisierte Osteuropa bis an die Grenze
zur Sowjetunion. Später noch über die Alpen,
Flüsse entlang, durch allerlei Länder. Damals
ließ ich auf dem Rad die Kindheit hinter mir. Es
war ein Freiheitsvehikel.
Nun, mit dem Kauf des neuen Rades, hatte ich
eine Entscheidung gefällt in einer
Lebensphase, in der man sonst eher wenige
Entschlüsse fasst. Hochzeit, Kinder, Wahl des
Wohnorts – in den Vierzigern liegt das einige
Zeit zurück. Aber sich ein Herz fassen?
Wenigstens ein neues Hobby erschließen? Das
macht Spaß und Männer in der Midlifecrisis zu
schwer berechenbaren Wesen.
Im Gegensatz zu einer Affäre oder dem Kauf
eines Sportwagens erschien mir meine Wahl
rational: Als Radfahrer würde ich gesund leben
und niemandem schaden. Zum Klimawandel
würde ich auch etwas weniger beitragen. Es
fühlte sich alles sehr gut und groß an. Leider
war das den anderen auf der Straße nicht klar.
Je öfter ich nun aufbrach, desto häufiger hatte
ich den Eindruck, dass ich für Autofahrer Luft
war. Radelte ich morgens fröhlich los, durch die
Vorortstraßen meiner Nachbarschaft, die
gegenüberliegende Fahrbahn zugeparkt, meine
Spur frei – zog jedes zweite mir
entgegenkommende Auto kompromisslos
durch. Ich bremste dann und blieb entweder
stehen oder quetschte mich an Straßenränder,
holperte durch Schlaglöcher, rumpelte über
Gullis. Einige Autofahrer bekamen davon nichts
mit, anderen war es offenbar egal. Mich ärgerte
das. Hätte ich in einem Auto gesessen, wären
die entgegenkommenden Wagen doch stehen
geblieben! Diese Missachtung tat mir weh.
Dass ich es da mit einem uralten
Menschheitsgefühl zu tun hatte, erklärte mir ein
belesener Bekannter: Schon vor 2500 Jahren
hatte Sophokles seinen Ödipus die gleiche
Erniedrigung erfahren lassen – mit den
bekannten Folgen. In Sophokles’ Drama ist der
tragische Held als Wanderer unterwegs, als
ihm auf schmalem Pfad ein "rossbespannter
Wagen" begegnet. Der Kutscher beharrt von
oben herab auf Durchfahrt, der Passagier im
Wagen gibt sich ebenso arrogant. Da erschlägt
Ödipus rasend vor Wut zunächst den Kutscher
und dann den Fahrgast, von dem er nicht weiß,
dass der sein Vater ist.
Es gilt § 6 der Straßenverkehrsordnung (StVO):
Wartepflichtig ist der, auf dessen Seite die
Fahrbahn blockiert ist. Sollte die verbliebene
Spur breit genug sein, dass zwei Fahrzeuge
passieren können, müssen beide ihre
Geschwindigkeit anpassen. Breit genug ist die
Spur aber nur dann, wenn der Radfahrer nicht
gezwungen wird, seinen Sicherheitsabstand
zum rechten Fahrbahnrand aufzugeben, und
das ihm entgegenkommende Auto dazu einen
Meter auf Distanz bleiben kann. Das ist selten
der Fall – und vorab eigentlich nie sicher
abzuschätzen.
Heute würden an der antiken Engstelle
vermutlich Verkehrsschilder stehen, jedenfalls
gibt es Regeln. Sie lesen sich
fußnotenkompliziert und sind letztlich doch
einfach. Auf seiner Straßenseite hat der
Radfahrer Vorfahrt. Doch das juckt die
Kutscher kaum.
Gemeinhin gelten wir Deutschen ja als
regelkonform, sogar regelgierig. Auf dem Rad
musste ich allerdings lernen, dass draußen ein
"Gesetz der Straße" gilt, ungeschrieben und
omnipräsent. Es ist der Gewohnheitsglaube,
dass Straßen den Autos gehören. Und dass 50
km/h Normalgeschwindigkeit sind.
Deshalb kommt sich ein Autofahrer in einer
30er-Zone ohnehin langsam vor ... und noch
langsamer, wenn ein Radfahrer mit 24 km/h
vorwegfährt. Da fährt er dicht auf, um seine
Ungeduld kundzutun. Da quetscht er sich
schnell vorbei, sobald sich die kleinste Lücke
auftut. Da vergisst er beim Öffnen der Fahrertür
den Schulterblick.
Nicht alles ist Absicht, einiges geschieht
unbewusst, oft handelt es sich nur um
Mikroaggressionen, wie Sozialpsychologen
wiederkehrende kleine Übergriffe nennen. Es
mag kaum der Rede wert sein, dass nahezu
alle Besitzer eines Geländewagens, der zu lang
oder zu breit für einen Parkplatz ist, den
Überhang ihres Gefährts nicht auf die Straße
ragen lassen, sondern auf den Geh- und
Radweg. In der Summe können solche
Mikroaggressionen makro sein: Irgendwann
kommt die alte Dame mit dem Rollator nicht
mehr durch, und auch ein Fahrradlenker ist zu
breit für den verbliebenen Raum.
Ich kann nicht genau sagen, ob mir all das auf
meinem neuen Rad wirklich öfter widerfuhr,
jedenfalls nahm ich es häufiger wahr. Aber lag
das an mir? Ich wollte mich nur mit der gleichen
Selbstverständlichkeit durch die Stadt bewegen
wie die anderen. Das war zu viel verlangt.
Zwar wird mittlerweile über autofreie
Innenstädte und Tempolimits diskutiert, aber
die Wahrheit lautet, frei nach James Brown:
This is a car’s world. Und das bis in die
hintersten Winkel unserer Gepflogenheiten und
Gehirne. Entfernungen machen wir uns in
"Autostunden" begreiflich. Sprachlich geben wir
im Berufsleben "Gas" und schalten im Urlaub
"einen Gang runter". In Zeitungen werden
Unfallmeldungen zu schuldlos überrollten
Passanten mit Überschriften wie "Kind gerät
unter Auto" oder "Radfahrerin stürzt in
abbiegenden Lkw" versehen. Stirbt jemand
ohne eigenes Zutun, fehlt nicht der Hinweis,
das Opfer habe leider keinen Helm getragen.
Irgendwie doch selbst schuld.
Stand je in einer Unfallmeldung, ein Auto, dem
die Vorfahrt genommen wurde, sei leider
"unauffällig lackiert" gewesen? Nein, so denken
wir nicht. Drei Viertel aller Neuwagen in
Deutschland sind nachtschwarz, regengrau
oder nebelweiß – während Fußgänger und
Radfahrer sich mit Reflektoren ausstaffieren
und bepolstern, sobald sie im Dunklen das
Haus verlassen. Als gingen sie einem
Extremsport nach. Dabei wollen sie nur zur
Schule, zur Arbeit oder kurz mit dem Hund
raus, der inzwischen auch Leuchtweste trägt.
Einmal, es war Winter, postete ich auf Twitter
ein Foto. Es zeigte eine vom Schnee geräumte
Straße, daneben einen vereisten Fuß- und
Radweg. Unter das Bild schrieb ich das Wort
"Prioritäten". Eine Antwort, die ich erhielt:
"Dann fahrt mit dem ÖPNV! Wenn bei solcher
Witterung jemand mit einem Zweirad vor mir
wegrutscht werde ich statt zu bremsen nochmal
schön das Lenkrad einschlagen und den Kopf
anvisieren. Fahrräder und alles unter 40 PS
haben nichts im Straßenverkehr zu suchen!!!!!"
Zivilisierter im Ton, aber ähnlich unnachgiebig
in der Sache gab sich einmal ein Herr, der für
seinen Geschmack nicht schnell genug an mir
vorbeikam, dann aber Zeit hatte, ein Fenster
herunterzulassen und zu rufen: "Sie wissen
schon, dass Sie ein Verkehrshindernis
darstellen!?" Für die Information, dass wir
beide Verkehrsteilnehmer sind, hatte er dann
schon wieder keine Zeit mehr.
Warum einige Menschen so ticken, hat mir ein
Sozialgeograf erklärt; ein Mann, der erforscht,
wie Gesellschaften ihre Umgebung prägen –
und die Umgebung dann wieder das Handeln
der Gesellschaft bestimmt. Deutschland, sagte
er, sei über Jahrzehnte ausschließlich für den
erwerbstätigen Teil der Bevölkerung gestaltet
worden. Früher waren das Berufstätige mit
Auto, meistens Männer. Alle Aspekte, die
entscheidend seien fürs Bruttosozialprodukt,
hätten Vorrang gehabt bei der materiellen
Gestaltung der Welt. Kinder, nach
ökonomischen Kriterien unproduktiv, werden
deshalb "in umzäunte Bereiche abgesondert",
Alte suchen sich mühsam ihre Wege, Frauen
hasten durch düstere Unterführungen. Wir sind
ein Land der Staubsaugervertreter, bis heute:
In der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, die der Politik vorschlägt, wie
breit ein Radweg sein darf und wie lange
Fußgänger auf Grün warten müssen, sitzen zu
über 80 Prozent Männer. Einige von ihnen
arbeiten hauptberuflich bei Straßenbaufirmen.
Zwar hat eine neue Stadtplaner-Generation die
Versäumnisse erkannt. Aber Straßen lassen
sich schlecht radikal umwidmen, allenfalls hier
und da mal hundert Meter. Zu alldem Beton
kommt noch das Beharren vieler. Nie waren in
Deutschland mehr Autos zugelassen als heute.
All das nahm ich jetzt klarer wahr. Als
Störfaktor für den "Verkehrsfluss" nach Kfz-
Kriterien schaute ich selbst verstört auf mein
bis dahin vertrautes Umfeld. Ähnlich wie
jemand, der kein Fleisch mehr essen will und
bemerkt, wie fleischbeladen unsere
Speisekarten sind.
Gewohntes erschien mir nun absonderlich:
Wären Zeitreisen möglich, dachte ich, und man
würde die Autos der Jetztzeit im Jahr 1950
abstellen, die Menschen wären erschrocken in
Anbetracht der grimmigen Kühlergrillgesichter,
die das Lächeln des VW Käfers verdrängt
haben. Vermutlich würden sich die Eltern von
damals auch beschweren, dass Kinder auf den
Straßen von heute nicht spielen könnten. Dass
wir uns indes damit abfinden, unseren Töchtern
und Söhnen eine Art Todesangst vor
Bordsteinkanten anzuerziehen, sobald sie
laufen lernen, liegt daran, dass sich die
Veränderung des Verkehrs schleichend statt
schlagartig vollzog. Wenn ein neues
Automodell größer ist als das alte, ist in der
Werbung immer von "Evolution" die Rede, als
vollziehe sich da ein natürlicher Prozess. Dabei
ist es Irrsinn. Zahllose Studien belegen es:
Straßenverkehr stellt hierzulande die größte
Quelle für Lärmbelästigung dar. Wenn Kinder
an einer dicht befahrenen Straße wohnen,
bewegen sie sich seltener und werden darüber
krank. Die meisten "Verkehrsfolgekosten" für
die Allgemeinheit verursacht das Auto. Diese
Aufzählung könnte endlos weitergehen.
Meine Entscheidung, mehr Rad zu fahren, war
also unbestreitbar vernünftig. So, wie es Sinn
ergibt, auf Fleisch zu verzichten. Aber mein
Entschluss war nicht üblich in dem Sinne, dass
die Mehrheit so handelt. Man gerät an den
Rand. Und dass Radfahrer in Deutschland eine
Randerscheinung sind, bekam ich zu spüren.
Nur kurz drei Klassiker, der Anschauung
wegen:
Klassiker 1: Gut gemeint, schlecht gemacht
Laut Gesetzeslage gilt der Überholabstand von
1,50 Metern innerorts auch an Schutzstreifen.
Es gibt Radwege. Und es gibt
"Radfahrschutzstreifen" am rechten
Fahrbahnrand, ein auf die Straße gestricheltes
Nichts in Autotür-Breite, für jede Kommune die
billigste Lösung, scheinbar etwas für Radler zu
tun. Das Resultat gleicht einer Todesfalle: Fährt
man mittig auf dem Schutzstreifen, bewegt man
sich stets in Tür-Reichweite der parkenden
Autos. Fährt man weiter links, schneiden einen
viele der überholenden Wagen, deren Fahrer ja
annehmen, bis zum Strichel-Strich gehöre die
Straße ihnen. Das tut sie nicht, aber wer würde
ohne Knautschzone darauf bestehen? Also
bleibt man als Radfahrer rechts, lauscht nach
hinten, blickt nach vorne und scannt jedes
parkende Auto auf die Möglichkeit einer sich
unversehens öffnenden Tür hin, auf jedwede
Spur von Leben, auf Fahrersilhouetten,
heruntergelassene Fenster, aufleuchtende
Rücklichter, sich aus- oder einklappende
Rückspiegel. Wer sich als Autofahrer schon
darüber ärgert, dass der Vordermann bei Grün
zu spät losfährt, kann gerne mal tauschen.
Klassiker 2: Unwissen vor Recht
Ist auf einem Fußweg ein weißes Schild zu
sehen, darauf die Silhouette eines Fahrrads
und das Wort "frei" – dann fühlen sich vor allem
ältere Autofahrer berufen, Radler von der
Straße zu hupen, sie zu bedrängen und zu
brüllen: "Da ist ein Radweg, du Idiot, benutz
doch den!" In Wahrheit ist es Nötigung. Denn
das weiße Schild signalisiert nur: Dies ist ein
Gehweg, auf dem auch Radler fahren dürfen.
Wenn sie wollen.
Die StVO unterscheidet grob gesagt zwischen
Radwegen mit Benutzungspflicht (blaue
Schilder) und solchen ohne (weiße Schilder).
Bei Letzteren liegt die Entscheidung beim
Radfahrer, ob er auf der Straße oder auf dem
Fußgängerweg fährt. Missverständnisse sind
dann hier wie dort wahrscheinlich.
Ein wirklich "benutzungspflichtiger" Radweg
befindet sich nur da, wo ein weißes Fahrrad auf
blauem Grund zu sehen ist. Aber wer weiß das
schon? Was gilt und was nicht, das
entscheiden laut Gesetz der Straße ja die
Autofahrer, nach meinem Eindruck vor allem
die angejahrten, die vor 40 Jahren in der
Fahrschule waren und denen man ihren
Irrglauben nicht ausreden kann. Denn nach
ihrem Umerziehungs-Überholmanöver sind sie
auf und davon, kopfschüttelnd.
Klassiker 3: Parabelflug
Ein Auto kommt aus einer Einfahrt, einer
Seitenstraße ... und hört nicht auf zu rollen,
rückt näher und näher. Für den Fahrer mag’s
sich "souverän" oder "sportlich" anfühlen, wenn
es ihm gelingt, den Radler vorbeizulassen,
ohne eine Sekunde zu viel zu verschenken. Als
gehe es nicht darum, auf eine Straße
einzubiegen, sondern um einen über Jahre
vorausberechneten Parabelflug durchs Weltall,
den man leider nicht mehr unterbrechen kann.
Dem Autofahrer erscheint sein Weiterrollen
also smart und dazu undramatisch, zumal er
den Radler ja sieht (falls er ihn denn sieht).
Der Radler erkennt aber durch die von außen
spiegelnden Scheiben des Autos den Fahrer
nicht und muss nach allerlei Erfahrungen
befürchten, gar nicht wahrgenommen worden
zu sein. Vorsichtshalber wird er langsamer,
wodurch die Überschlagsrechnung des
anrollenden Autofahrers endgültig nicht mehr
aufgeht ... und der Gas gibt, weil er annimmt,
der Radfahrer bleibe für ihn stehen. Das führt
dann wirklich zu Parabelflügen.
Wenn ich nun schreibe, dass mir trotz alldem
lange nichts passierte, klingt das so, als hätte
ich bis hierhin maßlos übertrieben. Allerdings
heißt "nichts passiert" nur: Ich hatte das Glück,
kein Pech zu haben. Es bedeutet, regelmäßig
geschnitten und von Rechtsabbiegern
übersehen worden zu sein, scharf gebremst
und aufmerksamen Autofahrern in
pantomimischen Ausdruckstänzen gedankt zu
haben, dass sie sich an Regeln hielten. "Nichts
passiert" hieß auch, abwägend kleine Risiken
eingegangen zu sein (in Schlaglöcher zu
steuern), um größere Risiken (Zusammenprall)
zu vermeiden. Es hieß, in Nebenstraßen
auszuweichen und längere Strecken in Kauf zu
nehmen. Und schließlich, morgens nicht
loszufahren, wann es meinen Bedürfnissen
entsprochen hätte, sondern bis mindestens
acht Uhr zu warten. Dann wurden die Straßen
leerer, waren weniger Eilige und
Dienstwagendringliche unterwegs. Ich lernte
die Stadt neu zu lesen, als Habitat, in dem ich
nicht heimisch war. Eine Antilope wagt sich
auch erst ans Wasserloch, wenn die Löwen
verschwunden sind.Dass all das als "nichts
passiert" erscheint, ist ein Teil des Problems.
weiterlesen
































