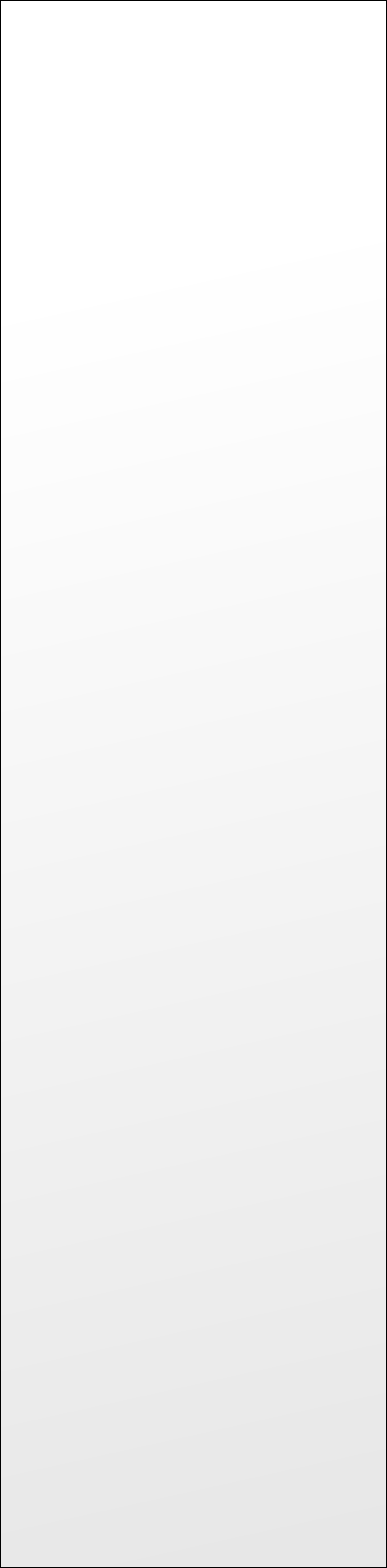
Essay – Wider den Bann
19. Februar 2016
Drogen sind gefährlich, aber noch gefährlicher ist die globale
Drogenpolitik. Wir brauchen eine neue.
Von Kofi Annan
Annan, 77, war von 1997 bis 2006 Generalsekretär der Vereinten Nationen. Im Jahr 2001
wurde der Ghanaer mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er lebt heute in Genf und
ist Vorsitzender der Kofi Annan Foundation, die sich für eine sicherere und friedlichere
Welt einsetzt.
Meiner Erfahrung nach ist eine Politik am erfolgreichsten, wenn unvoreingenommen
analysiert wird, was sich in der Praxis bewährt oder eben nicht bewährt hat. Richtlinien
hingegen, die auf allgemeinen Annahmen oder populären Stimmungen basieren, führen
leicht zu fehlgeleiteten Vorschriften und Maßnahmen.
Nirgendwo ist die Kluft zwischen Realität und Rhetorik so deutlich wie in der globalen
Drogenpolitik, wo sich allzu oft Emotionen und Ideologie durchsetzen und nicht die
wissenschaftlich fundierte Vernunft.
Nehmen Sie das Beispiel des medizinischen Gebrauchs von Cannabis. Wir wissen jetzt
aufgrund von Studien aus den USA, dass die Freigabe von Cannabis als Therapeutikum
die Zahl der jugendlichen Drogenkonsumenten nicht erhöht, was das am häufigsten
vorgebrachte Argument der Gegner dieser Freigabe widerlegt. Wohl aber hat sich in den
USA die Zahl der Todesfälle durch eine Überdosis Heroin zwischen 2010 und 2013 fast
verdreifacht – und das, obwohl die Gesetzeslage und die Androhung harter Strafen in
Bezug auf Heroin unverändert geblieben sind.
Im April wird die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu einer Sondersitzung
über die Drogenpolitik zusammenkommen. Diese Konferenz bietet der Welt die Chance,
ihren Kurs zu ändern – wir müssen uns daher fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Die Drogenpolitik der letzten 50 Jahre hat zu „unbeabsichtigten Konsequenzen“ geführt,
wie das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung einräumt.
Sie hat unter anderem einen enormen internationalen kriminellen Markt geschaffen, der
Gewalt, Korruption und Instabilität erzeugt. Denken Sie an die 16 000 Morde in Mexiko im
Jahr 2013 – der Großteil davon hat mit dem Drogenhandel zu tun.
Weltweit war der „Krieg gegen die Drogen“ nicht erfolgreich. Einigen Schätzungen zufolge
kostet die Durchsetzung der globalen Drogenverbote jährlich mindestens 100 Milliarden
Dollar, und trotzdem konsumieren um die 300 Millionen Menschen weltweit illegale
Drogen. Der resultierende Markt hat einen Umsatz von etwa 330 Milliarden Dollar, was ihn
zu einem der größten Rohstoffmärkte der Welt macht.
Verbote hatten bislang kaum eine Auswirkung auf das Angebot an oder die Nachfrage
nach Drogen. Wenn Strafverfolgung in einem Bereich der Drogenproduktion Erfolge hat,
wird sie einfach in eine andere Region oder ein anderes Land verlagert, der Drogenhandel
sucht sich eine andere Strecke, und die Drogenkonsumenten gehen zu anderen
Substanzen über.
Den Konsum haben Verbote ebenso wenig reduziert. Studien sind durchweg daran
gescheitert, eine Korrelation zwischen der Härte der Drogengesetze eines Landes und der
Höhe des Drogenkonsums zu finden. Die weit verbreitete Kriminalisierung und Bestrafung
von Drogenkonsumenten führt zu überfüllten Gefängnissen – und dies bedeutet, dass der
„Krieg gegen die Drogen“ zu einem erheblichen Grad ein Krieg gegen Menschen ist.
Afrika liefert leider ein Beispiel für diese Probleme. Die West Africa Commission on Drugs,
einberufen von meiner Stiftung, hat 2014 berichtet, dass die Region nicht mehr nur ein
wichtiges Transitgebiet ist für Drogen auf dem Weg von Lateinamerika zu den Kunden in
Europa. Westafrika konsumiert zunehmend die Drogen auch selbst. Das Geld aus dem
Drogenhandel und die damit verbundene Kriminalität leisten Korruption und Gewalt
Vorschub. Dies bedroht die Stabilität der einzelnen Länder und sogar der Region
insgesamt.
Ich glaube, dass Drogen viele Menschenleben zerstört haben – aber falsche Maßnahmen
seitens der Regierungen haben noch viel mehr Elend angerichtet. Wir alle möchten
unsere Familien schützen vor dem Schaden, den Drogen anrichten können. Aber sollten
unsere Kinder dennoch Probleme mit Rauschmitteln bekommen, so möchten wir doch
sicher, dass sie als Patienten behandelt werden, die eine medizinische Therapie
benötigen – und nicht, dass man sie brandmarkt als Kriminelle.
In weiten Teilen der Welt werden Drogennutzer stigmatisiert oder eingesperrt, und dies
hält viele davon ab, eine medizinische Behandlung zu beginnen. Wo sonst im
Gesundheitswesen kriminalisieren wir hilfsbedürftige Patienten? Die Strafmaßnahmen
haben viele Menschen ins Gefängnis gebracht, wo sich ihr Drogenkonsum nur noch
verschlimmert. Der Eintrag im Strafregister für ein kleines Drogenvergehen kann für einen
jungen Menschen eine viel stärkere Bedrohung seiner Zukunft bedeuten als der
gelegentliche Drogenkonsum selbst.
Die ursprüngliche Intention aller Drogenpolitik ist festgehalten in der Präambel des 1961
abgeschlossenen „Einheitsabkommens über die Betäubungsmittel“. Demnach soll sie „die
Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit“ schützen. Auf dieses wichtige Ziel
müssen wir die internationale und die nationale Drogenpolitik wieder ausrichten.
Deswegen müssen wir, muss die Weltgemeinschaft vier entscheidende Maßnahmen
ergreifen.
Erstens, wir müssen privaten Drogenkonsum entkriminalisieren. Drogengebrauch ist
gesundheitsschädlich; diese Schäden zu verringern muss aber eine Aufgabe des
Gesundheitssystems sein, nicht der Gerichte. Die Behandlungsmöglichkeiten für
Drogensüchtige müssen ausgebaut werden, allen voran in den Ländern mit geringem bis
mittlerem Einkommen.
Zweitens müssen wir akzeptieren, dass eine drogenfreie Welt eine Illusion ist. Wir sollten
uns vielmehr darauf konzentrieren sicherzustellen, dass Drogen nur den
geringstmöglichen Schaden anrichten. Maßnahmen zur Schadensminderung, etwa
Programme zur Bereitstellung steriler Nadeln bei Heroinsüchtigen, haben beeindruckende
Erfolge erzielt. Deutschland hat solche Ideen früh umgesetzt, und daher liegt dort die Rate
der HIV-Infektionen unter Drogen injizierenden Personen bei rund 5 Prozent. In den
Ländern, die sich einem solch pragmatischen Ansatz verweigern, übertrifft sie nicht selten
40 Prozent.
Drittens: Wir müssen die totale Unterdrückung von Drogen als Ziel aufgeben, denn wir
wissen, dass sie nicht funktionieren wird. Stattdessen müssen wir Drogen staatlich
regulieren und besser über sie aufklären. Als Vorbild kann die erfolgreiche Reduktion des
Tabakkonsums dienen, einer sehr starken und gefährlichen Sucht. Der Anteil der Raucher
ist in vielen Ländern gesunken, und zwar nicht wegen der Drohung mit Gefängnisstrafen,
sondern einzig über Regulierung und Aufklärung. Höhere Steuern,
Verkaufsbeschränkungen und wirkungsvolle Nichtraucherkampagnen haben die richtigen
Resultate erzielt.
Der legale Verkauf von Cannabis ist bereits Realität, seit Kalifornien im Jahr 1996 die
Abgabe von Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert hat. Seitdem sind 22 US-
Bundesstaaten und einige europäische Länder diesem Beispiel gefolgt. Andere sind noch
weiter gegangen. Ein Volksentscheid hat im US-Staat Colorado zur Legalisierung des
Verkaufs von Cannabis für den Freizeitgebrauch geführt. Im vergangenen Jahr nahm
Colorado rund 135 Millionen Dollar durch Steuern auf den legalen Cannabisverkauf und
damit zusammenhängende Lizenzgebühren ein. Andere haben weniger kommerzielle
Wege eingeschlagen. Mitglieder spanischer Cannabis-Vereine können Cannabis in
kleinen, nicht kommerziellen Organisationen anbauen und kaufen. Und es sieht so aus,
als würde Kanada noch dieses Jahr das erste G-7-Land werden, das den Verkauf von
Cannabis rechtlich regelt.
Erste Trends zeigen, dass es dort, wo Cannabis legalisiert worden ist, keine Explosion des
Drogenkonsums oder der Beschaffungskriminalität gegeben hat. Die Größe des
Schwarzmarkts wurde reduziert, und Tausenden jungen Menschen ist ein Eintrag ins
Strafregister erspart geblieben. Aber ein geregelter Markt ist kein freier Markt. Wir müssen
sorgfältig durchdenken, was der Regelung bedarf und was nicht. Obwohl ein Großteil der
Nutzer Cannabis nur gelegentlich und maßvoll konsumiert und dies nicht mit erheblichen
Problemen verbunden ist, muss allein wegen der potenziellen Risiken der Konsum
gesetzlich geregelt werden.
Damit komme ich zu meinem letzten Punkt: Es muss endlich anerkannt werden, dass
Drogen staatlicher Regulierung bedürfen, weil sie so gefährlich sind. Es ist Zeit für die
Einsicht, dass Rauschmittel unendlich viel gefährlicher sind, wenn sie einzig und allein in
den Händen von Kriminellen liegen, die sich naturgemäß um Gesundheit und Sicherheit
ihrer Kunden nicht scheren. Die gesetzliche Regelung schützt die Gesundheit. Die
Verbraucher müssen sich im Klaren sein, was sie einnehmen, und darüber informiert
werden, welche Gesundheitsrisiken damit verbunden sind und wie sie diese minimieren
können. Regierungen müssen in der Lage sein, Hersteller und Verkaufsstellen zu
regulieren, je nachdem wie viel Schaden eine Droge verursachen kann. Die gefährlichsten
Drogen sollten nie einfach „über den Ladentisch“ gehen, sondern zum Beispiel nur auf
ärztliche Verschreibung für abhängige Nutzer erhältlich sein, wie es bereits in der Schweiz
geschieht.
Die wissenschaftliche Beleglage und unsere Sorge um Gesundheit und Menschenrechte
müssen die künftige Drogenpolitik bestimmen. Wir müssen die Zahl der Menschen
senken, die an einer Überdosis sterben. Wir müssen verhindern, dass
Gelegenheitskonsumenten im Gefängnis landen, wo ihre Drogenprobleme nur schlimmer
werden. Es ist Zeit für eine klügere, gesundheitsorientierte Drogenpolitik.
Es ist Zeit dafür, dass Länder wie Deutschland, die daheim zum Teil bereits eine bessere
Politik verfolgen, sich stark machen für einen Politikwandel in anderen Teilen der Welt.
Dafür bietet die Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum
globalen Drogenproblem eine gute Gelegenheit.
Der „Krieg gegen die Drogen“ ist zu einem erheblichen Teil ein Krieg gegen Menschen.
Quelle: https://zeitungspiraten.net/derspiegel/heft-8-2016/essay-wider-den-bann-
1758.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de
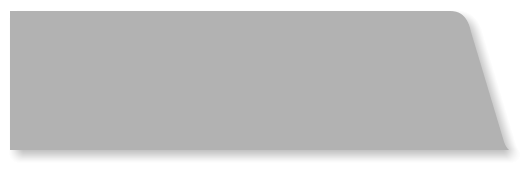


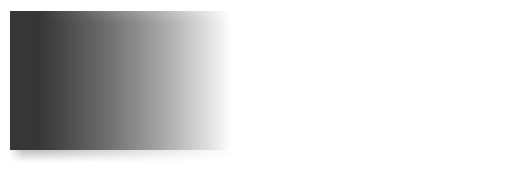
Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
© strapp 2016

Essay – Wider den Bann
19. Februar 2016
Drogen sind gefährlich, aber
noch gefährlicher ist die
globale Drogenpolitik. Wir
brauchen eine neue.
Von Kofi Annan
Annan, 77, war von 1997 bis 2006
Generalsekretär der Vereinten
Nationen. Im Jahr 2001 wurde der
Ghanaer mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet. Er lebt heute in Genf
und ist Vorsitzender der Kofi Annan
Foundation, die sich für eine
sicherere und friedlichere Welt
einsetzt.
Meiner Erfahrung nach ist eine Politik
am erfolgreichsten, wenn
unvoreingenommen analysiert wird,
was sich in der Praxis bewährt oder
eben nicht bewährt hat. Richtlinien
hingegen, die auf allgemeinen
Annahmen oder populären
Stimmungen basieren, führen leicht
zu fehlgeleiteten Vorschriften und
Maßnahmen.
Nirgendwo ist die Kluft zwischen
Realität und Rhetorik so deutlich wie
in der globalen Drogenpolitik, wo sich
allzu oft Emotionen und Ideologie
durchsetzen und nicht die
wissenschaftlich fundierte Vernunft.
Nehmen Sie das Beispiel des
medizinischen Gebrauchs von
Cannabis. Wir wissen jetzt aufgrund
von Studien aus den USA, dass die
Freigabe von Cannabis als
Therapeutikum die Zahl der
jugendlichen Drogenkonsumenten
nicht erhöht, was das am häufigsten
vorgebrachte Argument der Gegner
dieser Freigabe widerlegt. Wohl aber
hat sich in den USA die Zahl der
Todesfälle durch eine Überdosis
Heroin zwischen 2010 und 2013 fast
verdreifacht – und das, obwohl die
Gesetzeslage und die Androhung
harter Strafen in Bezug auf Heroin
unverändert geblieben sind.
Im April wird die
Generalversammlung der Vereinten
Nationen zu einer Sondersitzung über
die Drogenpolitik zusammenkommen.
Diese Konferenz bietet der Welt die
Chance, ihren Kurs zu ändern – wir
müssen uns daher fragen, ob wir auf
dem richtigen Weg sind.
Die Drogenpolitik der letzten 50 Jahre
hat zu „unbeabsichtigten
Konsequenzen“ geführt, wie das Büro
der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung
einräumt. Sie hat unter anderem
einen enormen internationalen
kriminellen Markt geschaffen, der
Gewalt, Korruption und Instabilität
erzeugt. Denken Sie an die 16 000
Morde in Mexiko im Jahr 2013 – der
Großteil davon hat mit dem
Drogenhandel zu tun.
Weltweit war der „Krieg gegen die
Drogen“ nicht erfolgreich. Einigen
Schätzungen zufolge kostet die
Durchsetzung der globalen
Drogenverbote jährlich mindestens
100 Milliarden Dollar, und trotzdem
konsumieren um die 300 Millionen
Menschen weltweit illegale Drogen.
Der resultierende Markt hat einen
Umsatz von etwa 330 Milliarden
Dollar, was ihn zu einem der größten
Rohstoffmärkte der Welt macht.
Verbote hatten bislang kaum eine
Auswirkung auf das Angebot an oder
die Nachfrage nach Drogen. Wenn
Strafverfolgung in einem Bereich der
Drogenproduktion Erfolge hat, wird
sie einfach in eine andere Region
oder ein anderes Land verlagert, der
Drogenhandel sucht sich eine andere
Strecke, und die Drogenkonsumenten
gehen zu anderen Substanzen über.
Den Konsum haben Verbote ebenso
wenig reduziert. Studien sind
durchweg daran gescheitert, eine
Korrelation zwischen der Härte der
Drogengesetze eines Landes und der
Höhe des Drogenkonsums zu finden.
Die weit verbreitete Kriminalisierung
und Bestrafung von
Drogenkonsumenten führt zu
überfüllten Gefängnissen – und dies
bedeutet, dass der „Krieg gegen die
Drogen“ zu einem erheblichen Grad
ein Krieg gegen Menschen ist.
Afrika liefert leider ein Beispiel für
diese Probleme. Die West Africa
Commission on Drugs, einberufen
von meiner Stiftung, hat 2014
berichtet, dass die Region nicht mehr
nur ein wichtiges Transitgebiet ist für
Drogen auf dem Weg von
Lateinamerika zu den Kunden in
Europa. Westafrika konsumiert
zunehmend die Drogen auch selbst.
Das Geld aus dem Drogenhandel und
die damit verbundene Kriminalität
leisten Korruption und Gewalt
Vorschub. Dies bedroht die Stabilität
der einzelnen Länder und sogar der
Region insgesamt.
Ich glaube, dass Drogen viele
Menschenleben zerstört haben –
aber falsche Maßnahmen seitens der
Regierungen haben noch viel mehr
Elend angerichtet. Wir alle möchten
unsere Familien schützen vor dem
Schaden, den Drogen anrichten
können. Aber sollten unsere Kinder
dennoch Probleme mit Rauschmitteln
bekommen, so möchten wir doch
sicher, dass sie als Patienten
behandelt werden, die eine
medizinische Therapie benötigen –
und nicht, dass man sie brandmarkt
als Kriminelle.
In weiten Teilen der Welt werden
Drogennutzer stigmatisiert oder
eingesperrt, und dies hält viele davon
ab, eine medizinische Behandlung zu
beginnen. Wo sonst im
Gesundheitswesen kriminalisieren wir
hilfsbedürftige Patienten? Die
Strafmaßnahmen haben viele
Menschen ins Gefängnis gebracht,
wo sich ihr Drogenkonsum nur noch
verschlimmert. Der Eintrag im
Strafregister für ein kleines
Drogenvergehen kann für einen
jungen Menschen eine viel stärkere
Bedrohung seiner Zukunft bedeuten
als der gelegentliche Drogenkonsum
selbst.
Die ursprüngliche Intention aller
Drogenpolitik ist festgehalten in der
Präambel des 1961 abgeschlossenen
„Einheitsabkommens über die
Betäubungsmittel“. Demnach soll sie
„die Gesundheit und das
Wohlergehen der Menschheit“
schützen. Auf dieses wichtige Ziel
müssen wir die internationale und die
nationale Drogenpolitik wieder
ausrichten.
Deswegen müssen wir, muss die
Weltgemeinschaft vier entscheidende
Maßnahmen ergreifen.
Erstens, wir müssen privaten
Drogenkonsum entkriminalisieren.
Drogengebrauch ist
gesundheitsschädlich; diese Schäden
zu verringern muss aber eine
Aufgabe des Gesundheitssystems
sein, nicht der Gerichte. Die
Behandlungsmöglichkeiten für
Drogensüchtige müssen ausgebaut
werden, allen voran in den Ländern
mit geringem bis mittlerem
Einkommen.
Zweitens müssen wir akzeptieren,
dass eine drogenfreie Welt eine
Illusion ist. Wir sollten uns vielmehr
darauf konzentrieren sicherzustellen,
dass Drogen nur den
geringstmöglichen Schaden
anrichten. Maßnahmen zur
Schadensminderung, etwa
Programme zur Bereitstellung steriler
Nadeln bei Heroinsüchtigen, haben
beeindruckende Erfolge erzielt.
Deutschland hat solche Ideen früh
umgesetzt, und daher liegt dort die
Rate der HIV-Infektionen unter
Drogen injizierenden Personen bei
rund 5 Prozent. In den Ländern, die
sich einem solch pragmatischen
Ansatz verweigern, übertrifft sie nicht
selten 40 Prozent.
Drittens: Wir müssen die totale
Unterdrückung von Drogen als Ziel
aufgeben, denn wir wissen, dass sie
nicht funktionieren wird. Stattdessen
müssen wir Drogen staatlich
regulieren und besser über sie
aufklären. Als Vorbild kann die
erfolgreiche Reduktion des
Tabakkonsums dienen, einer sehr
starken und gefährlichen Sucht. Der
Anteil der Raucher ist in vielen
Ländern gesunken, und zwar nicht
wegen der Drohung mit
Gefängnisstrafen, sondern einzig
über Regulierung und Aufklärung.
Höhere Steuern,
Verkaufsbeschränkungen und
wirkungsvolle
Nichtraucherkampagnen haben die
richtigen Resultate erzielt.
Der legale Verkauf von Cannabis ist
bereits Realität, seit Kalifornien im
Jahr 1996 die Abgabe von Cannabis
für medizinische Zwecke legalisiert
hat. Seitdem sind 22 US-
Bundesstaaten und einige
europäische Länder diesem Beispiel
gefolgt. Andere sind noch weiter
gegangen. Ein Volksentscheid hat im
US-Staat Colorado zur Legalisierung
des Verkaufs von Cannabis für den
Freizeitgebrauch geführt. Im
vergangenen Jahr nahm Colorado
rund 135 Millionen Dollar durch
Steuern auf den legalen
Cannabisverkauf und damit
zusammenhängende Lizenzgebühren
ein. Andere haben weniger
kommerzielle Wege eingeschlagen.
Mitglieder spanischer Cannabis-
Vereine können Cannabis in kleinen,
nicht kommerziellen Organisationen
anbauen und kaufen. Und es sieht so
aus, als würde Kanada noch dieses
Jahr das erste G-7-Land werden, das
den Verkauf von Cannabis rechtlich
regelt.
Erste Trends zeigen, dass es dort, wo
Cannabis legalisiert worden ist, keine
Explosion des Drogenkonsums oder
der Beschaffungskriminalität gegeben
hat. Die Größe des Schwarzmarkts
wurde reduziert, und Tausenden
jungen Menschen ist ein Eintrag ins
Strafregister erspart geblieben. Aber
ein geregelter Markt ist kein freier
Markt. Wir müssen sorgfältig
durchdenken, was der Regelung
bedarf und was nicht. Obwohl ein
Großteil der Nutzer Cannabis nur
gelegentlich und maßvoll konsumiert
und dies nicht mit erheblichen
Problemen verbunden ist, muss allein
wegen der potenziellen Risiken der
Konsum gesetzlich geregelt werden.
Damit komme ich zu meinem letzten
Punkt: Es muss endlich anerkannt
werden, dass Drogen staatlicher
Regulierung bedürfen, weil sie so
gefährlich sind. Es ist Zeit für die
Einsicht, dass Rauschmittel unendlich
viel gefährlicher sind, wenn sie einzig
und allein in den Händen von
Kriminellen liegen, die sich
naturgemäß um Gesundheit und
Sicherheit ihrer Kunden nicht
scheren. Die gesetzliche Regelung
schützt die Gesundheit. Die
Verbraucher müssen sich im Klaren
sein, was sie einnehmen, und
darüber informiert werden, welche
Gesundheitsrisiken damit verbunden
sind und wie sie diese minimieren
können. Regierungen müssen in der
Lage sein, Hersteller und
Verkaufsstellen zu regulieren, je
nachdem wie viel Schaden eine
Droge verursachen kann. Die
gefährlichsten Drogen sollten nie
einfach „über den Ladentisch“ gehen,
sondern zum Beispiel nur auf
ärztliche Verschreibung für abhängige
Nutzer erhältlich sein, wie es bereits
in der Schweiz geschieht.
Die wissenschaftliche Beleglage und
unsere Sorge um Gesundheit und
Menschenrechte müssen die künftige
Drogenpolitik bestimmen. Wir
müssen die Zahl der Menschen
senken, die an einer Überdosis
sterben. Wir müssen verhindern,
dass Gelegenheitskonsumenten im
Gefängnis landen, wo ihre
Drogenprobleme nur schlimmer
werden. Es ist Zeit für eine klügere,
gesundheitsorientierte Drogenpolitik.
Es ist Zeit dafür, dass Länder wie
Deutschland, die daheim zum Teil
bereits eine bessere Politik verfolgen,
sich stark machen für einen
Politikwandel in anderen Teilen der
Welt. Dafür bietet die Sondersitzung
der Generalversammlung der
Vereinten Nationen zum globalen
Drogenproblem eine gute
Gelegenheit.
Der „Krieg gegen die Drogen“ ist zu
einem erheblichen Teil ein Krieg
gegen Menschen.
Quelle:
https://zeitungspiraten.net/derspiegel/heft-8-
2016/essay-wider-den-bann-
1758.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fw
ww.google.de
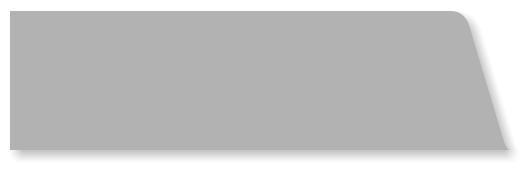


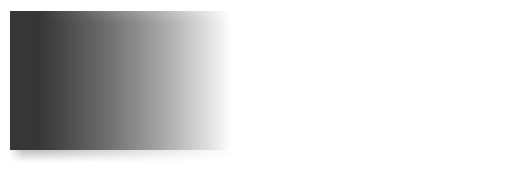
© strapp 2016































