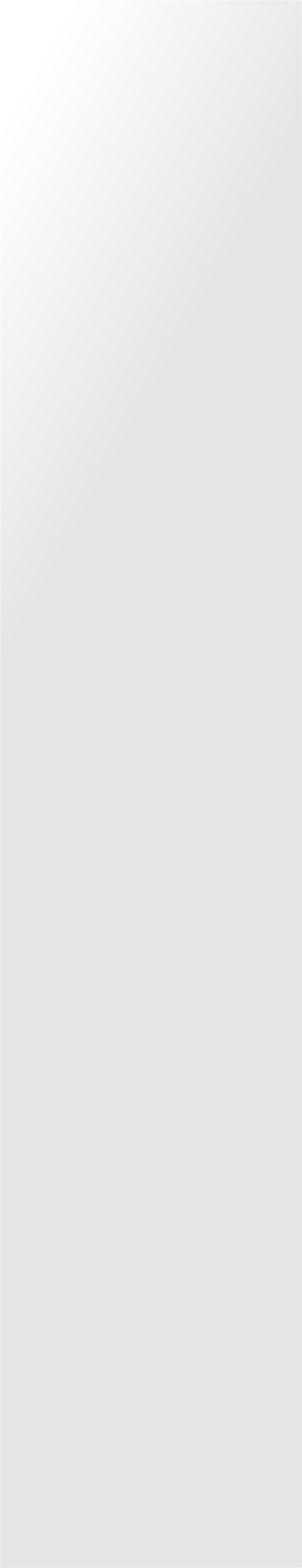
ZUM BEISPIEL ERINNERUNG
Veränderung fällt schwer: Die Neurobiologie hat
festgestellt, dass sich unsere Persönlichkeit durch
jahrelange Erfahrungen festigt. Wie bleibt man dennoch
offen für Neues? Der Hirnforscher Gerhard Roth sieht
dafür zwei Voraussetzungen: Positive Einwirkungen und
einen langen Atem.
Interview: Philipp Hauner
Herr Roth, trotz guter Vorsätze
gelingt es uns oft nicht, geplante
Veränderungen auch umzusetzen.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Zwischen dem Willen, sich zu
verändern und der tatsächlichen
Realisierung liegen Prozesse der
Überprüfung. Sie spielen sich in
unserem vorbewussten und
unbewussten Erfahrungs-gedächtnis
ab. Dort werden Veränderungswünsche
im Lichte vergangener Erfahrungen
beurteilt und anschließend entscheidet
sich, ob sie tatsächlich realisiert
werden. Es mag also längst vergessene
Erfahrungen, unbewusste Motive oder
gar Zwänge geben, die Veränderungen
entgegenstehen.
Was geschieht aus
neurowissenschaftlicher Sicht,
wenn wir neue Erfahrungen
machen?
Alles, was wir erleben oder tun, wird
vom Gehirn nach seinen Folgen
bewertet. Luft etwas gut, so wird an die
Erinnerung der Ausstoß von
Belohnungsstoffen gehängt, das sind
sogenannte hirneigene Opioide und
Cannabinoide, und wir fühlen uns
prächtig. Gleichzeitig wird das Ganze
mit einem Signal des Botenstoffs
Dopamin versehen – das treibt uns
zusammen mit den gespeicherten
Gedächtnisinhalten an, Dinge zu
wiederholen, die zumindest einmal gut
gelaufen sind. Bei negativen
Erfahrungen läuft das über andere
Stoffe ähnlich und resultiert in
Vermeidungsverhalten.
Unser Gehirn macht uns also zu
Wiederholungstätern. Werden
wir deshalb Gewohnheiten wie
das Rauchen nur schwer wieder
los?
Nikotin ist bekanntlich eine Droge und
ebenso wie Alkohol und künstliche
Drogen wirkt es als Belohnungsstoff
außerordentlich viel stärker als die
Selbstbelohnungsstoffe des Gehirns.
Deshalb wird der Drang, das dadurch
Belohnte wieder zu tun oder wieder zu
erleben, übermächtig und damit zur
Sucht. Allerdings lässt die Wirkung oft
schnell nach und was bleibt, ist der
Entzugsschmerz, der dann über die
erneute Einnahme der Droge
vorübergehend gelindert wird. Eine
Sucht verstellt nachhaltig Netzwerke im
Belohnungssystem des Gehirns. Daher
ist sie nur sehr schwer zu beseitigen.
Angenommen, wir haben die
angestrebten Veränderungen
erreicht – können wir uns denn
darauf verlassen, dass sie Bestand
haben werden?
Verhaltensmuster bleiben im Gehirn
grundsätzlich bestehen und werden
auch durch Verhaltensänderungen
niemals ausgelöscht, sondern nur
überlernt. Das ist immer eine wackelige
Sache – und unter besonderen
Belastungs- oder
Bedürfnisbedingungen fällt man wieder
in die alten Muster zurück.
Sie konnten zeigen, dass nur
zwanzig Prozent unserer
Persönlichkeit formbar sind –
welche sind das?
Dieser Wert bezieht sich auf die
Situation im Erwachsenenalter. Im
frühen Kindesalter ist vieles durch
frühe Erfahrungen und
Prägungserlebnisse veränderbar.
Unsere Persönlichkeit stabilisiert sich
zunehmend bis etwa zum sechzehnten
Lebensjahr. Danach haben wir nur
noch begrenzte
Veränderungsmöglichkeiten, die nicht
mehr den Kern unserer Persönlichkeit
betreffen. Der Aufwand, der für eine
Veränderung betrieben werden muss,
steigt zunehmend.
Uns zu verändern wird immer
unbequemer?
Persönlichkeitspsychologen sind der
Ansicht, dass wir uns ab dem späten
Jugendalter nicht mehr so sehr neuen
Lebensumständen anpassen, sondern
uns eher diejenigen Umstände suchen,
die zu unserer Persönlichkeit passen.
Umgekehrt heißt das: je früher
wir uns ändern, desto leichter tun
wir uns?
Es ist richtig, dass Änderungen in der
Persönlichkeit umso leichter erfolgen,
je früher sie geschehen – zum Teil
finden sie schon vorgeburtlich statt.
Allerdings vollzieht sich dies in der
Regel nicht aus freiem Willen, sondern
unter dem Einfluss der individuellen
und sozialen Umwelt, insbesondere der
frühkindlichen Bindungserfahrung.
Deshalb kann man nicht von einer
bewussten Veränderung sprechen.
Was ist der evolutionäre
Hintergedanke dabei, dass wir
uns gar nicht so stark selbst
formen können, wie wir das
vermutlich glauben?
Jede Gemeinschaft beruht auf einer
hohen Verlässlichkeit und
Vorausschaubarkeit des Verhaltens
ihrer Individuen. Unsere Gesellschaft
könnte nicht bestehen, wenn wir uns
alle jederzeit stark ändern würden – ob
nun aus innerem Antrieb oder aufgrund
äußerlicher Einflüsse. Junge Menschen
erlangen hinsichtlich ihrer
Persönlichkeit zunehmend eine
Stabilität des Handelns – wir nennen
das „Erwachsenwerden“. Genau das
bezwecken schließlich auch
gesellschaftliche Normen.
Sind wir so programmiert, dass
wir auf Veränderungen, die von
außen auf uns Einfluss nehmen,
am liebsten mit Anpassung
reagieren?
Veränderungen werden in der Tat meist
von außen angestoßen. Wir folgen
ihnen dann innerhalb des weiten oder
engen Rahmens, den unsere
Persönlichkeit vorgibt. Die meisten
Menschen verändern sich bei
Herausforderungen nur wenig, sie
versuchen, ihnen durch Ausweichen zu
entgehen, indem sie günstigere
Bedingungen suchen. Was nach
Anpassung aussieht, ist oft nur
Vermeidung.
Formt uns unser Umfeld stärker
als wir annehmen?
Das Ausmaß der Fähigkeit zur
Veränderung ist Teil unserer
Persönlichkeit: Während manche
Menschen Veränderungen lieben,
mögen die meisten keine allzu
tiefgreifenden. Es gibt allerdings auch
eine gewisse soziokulturelle Umwelt,
die Veränderungen unterstützt oder
erschwert. So sind US-Amerikaner eher
veränderungsgeneigt und Deutsche eher
veränderungsaversiv – in beiden Fällen
wohl aus geschichtlichen Gründen.
Wie steht es denn um unsere
Vernunft – helfen gute Argumente
für Veränderungen?
Gute Argumente appellieren an unseren
Verstand, der ohne eine bewusste oder
unbewusste emotionale Verstärkung
keinen eigenen Einfluss auf unser
Verhalten hat. Und schließlich handelt
es sich auch nur um unsere eigenen
Argumente. Wir glauben
irrtmlicherweise, es gäbe eine
überindividuelle Ratio. Aber was dem
einen höchst einleuchtend vorkommt,
muss es einem anderen noch lange nicht
tun.
Ist das nicht ein
niederschmetternder Befund?
Nur bei oberflächlicher Betrachtung –
denn was uns am besten antreibt, ist
über Jahre oder Jahrzehnte erworbene
Erfahrung, die oft als Intuition oder
Gefühl vorliegt. Gedanken kommen und
gehen, unsere Erfahrung bleibt.
Tun sich neugierige oder
phantasievolle Menschen
eigentlich leichter damit,
Veränderungen anzustoßen?
Es gehört zum Naturell dieser offenen
Menschen, dass ihnen Veränderungen
grundsätzlich gefallen. Sie langweilen
sich aber auch schneller.
Und Empathie – kann man sie
trainieren oder erlernen?
Wir haben eine angeborene Neigung zu
Empathie. Sie muss aber durch die
frühkindliche Bindungserfahrung
bestärkt werden. Geschieht dies nicht,
kann man Empathie später nur noch
sehr begrenzt trainieren. Es wird zum
Beispiel bei Gewaltverbrechern versucht,
bleibt aber meist zwecklos.
Was ist davon zu halten, wenn uns
Freunde oder Kollegen berichten,
dass sie sich stark verändert
haben?
Das kommt auf die Gründe an. Manche
Menschen ändern sich tatsächlich, weil
sie tiefgreifende oder langanhaltende
langanhaltende positive oder
insbesondere negative Erfahrungen
gemacht haben. Die meisten Menschen
verwechseln aber eine relativ
oberflächliche Veränderung – einen
neuen Wohnort, einen neuen Job oder
einen neuen Partner – mit
Veränderungen in der Struktur ihrer
Persönlichkeit. Die ändert sich im
Erwachsenenalter nur schwer und
langsam.
Gibt es ideale Voraussetzungen,
damit positive und nachhaltige
Veränderungen geschehen?
Es gibt im Grunde nur zwei
Bedingungen für eine tiefgreifende
Veränderung unserer Persönlichkeit. Ein
schockartiges Erlebnis, das uns zur
Umkehr bringt, oder jahrelange
Einwirkungen von irgendwo her – meist
vom Partner. Aber auch das funktioniert
nicht verlässlich, denn ein jahrelang
nörgelndes Gegenüber kann einen
schließlich auch dazu bringen, die Koffer
zu packen.
Das schockartige Erlebnis würde
immerhin die biblische Geschichte
erklären, wie aus Saulus auf
einmal Paulus wurde...
Saulus war allem Anschein nach
Epileptiker und hatte einen „großen
Anfall“ vor Damaskus. Dazu passt der in
der Apostelgeschichte überlieferte
Bericht einer Erscheinung mit Stimme –
die meisten Propheten aller
Offenbarungsreligionen berichten
davon.
Eine derartige Erscheinung lsst
sich wissenschaftlich beschreiben?
Ja. In der Großhirnrinde fallen
hemmende Mechanismen, die
sogenannten inhibitorischen
Nervenzellen, aus und es kommt zu
einem regelrechten Erregungssturm.
Das kann auch lokal geschehen,
beispielsweise im rechten
Schläfenlappen, wo Nervennetze
lokalisiert sind, die mit Empathie,
Bindung und starken, oft religiösen
Gefühlen, mit Erleuchtung, Ekstase und
visuellen und auditorischen
Halluzinationen zu tun haben. Wird dort
starke Erregung ausgelöst, kommt es bei
Persönlichkeiten, die schon zuvor sehr
religiös orientiert waren, zu
Offenbarungshalluzinationen. Das
Ganze kann sich auch bei sensorischer
Isolation ergeben – wenn also „heilige
Männer“ lange völlig zurückgezogen in
der Wüste leben. Sensorische Isolation
bringt die Eigenaktivität des Gehirns
zum überborden.
Erst wenn es gar nicht mehr
anders geht, wachen wir auf und
verändern uns. Können Sie als
Hirnforscher dieser These
zustimmen?
Ja! Die meisten Menschen ändern sich
nur, wenn ihnen die „Schiete bis zum
Hals steht“ – Leidensdruck ist sehr
wichtig für Veränderungen.
Heißt das, Krisenzeiten sind gute
Zeiten, um Veränderungen in
Gang zu bringen?
Wahrscheinlich, obwohl uns das nicht
besonders gefällt. Politisch-
gesellschaftliche Krisenzeiten waren
meist kulturelle und intellektuelle
Blütezeiten – beispielsweise die
Weimarer Republik vor den Nazis. Die
Menschen werden dann stärker mit
Herausforderungen konfrontiert.
Neurowissenschaftlich betrachtet:
Wo würden Sie ansetzen, wenn Sie
die politische Gestaltungsmacht
hätten?
Ich würde in der Früherziehung der
Kinder und in der Schule ansetzen, denn
dort können Menschen sich noch gut
entwickeln. Gerade junge Menschen
sollten heute offener und toleranter,
neugieriger und selbstbestimmter
werden. Und verantwortungsvoller.
Viele Deutsche hängen zu sehr an den
Dienstleistungen des Sozialstaats und
fürchten sich vor Veränderungen – was
man gerade drastisch sieht. Insgesamt
muss man dagegen etwas tun, denn
Veränderungsangst lähmt das Denken
und die Kreativität. •
Quelle: Das Magazin der Grünen –
Mitgliederzeitschrift für bündnisgrüne
Politik Nr. 1, ISSN 1434-3835

GERHARD ROTH
ist Neurobiologe und Hirnforscher an der
Universität Bremen. Fr seine Verdienste
in der Wissenschaft und die Förderung
von Schülern aus bildungsfernen
Elternhusern wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz verliehen.




Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome

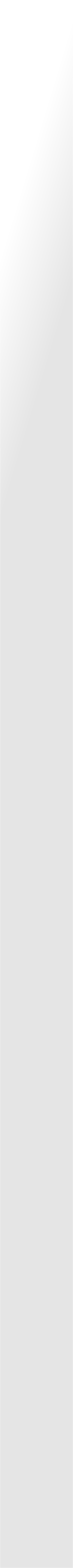
ZUM BEISPIEL
ERINNERUNG
Veränderung fällt schwer: Die
Neurobiologie hat festgestellt, dass
sich unsere Persönlichkeit durch
jahrelange Erfahrungen festigt.
Wie bleibt man dennoch offen für
Neues? Der Hirnforscher Gerhard
Roth sieht dafür zwei
Voraussetzungen: Positive
Einwirkungen und einen langen
Atem.
Interview: Philipp Hauner
Herr Roth, trotz guter Vorsätze
gelingt es uns oft nicht, geplante
Veränderungen auch
umzusetzen. Haben Sie dafür
eine Erklärung?
Zwischen dem Willen, sich zu
verändern und der tatsächlichen
Realisierung liegen Prozesse der
Überprüfung. Sie spielen sich in
unserem vorbewussten und
unbewussten Erfahrungs-gedächtnis
ab. Dort werden
Veränderungswünsche im Lichte
vergangener Erfahrungen beurteilt und
anschließend entscheidet sich, ob sie
tatsächlich realisiert werden. Es mag
also längst vergessene Erfahrungen,
unbewusste Motive oder gar Zwänge
geben, die Veränderungen
entgegenstehen.
Was geschieht aus
neurowissenschaftlicher Sicht,
wenn wir neue Erfahrungen
machen?
Alles, was wir erleben oder tun, wird
vom Gehirn nach seinen Folgen
bewertet. Luft etwas gut, so wird an die
Erinnerung der Ausstoß von
Belohnungsstoffen gehängt, das sind
sogenannte hirneigene Opioide und
Cannabinoide, und wir fühlen uns
prächtig. Gleichzeitig wird das Ganze
mit einem Signal des Botenstoffs
Dopamin versehen – das treibt uns
zusammen mit den gespeicherten
Gedächtnisinhalten an, Dinge zu
wiederholen, die zumindest einmal gut
gelaufen sind. Bei negativen
Erfahrungen läuft das über andere
Stoffe ähnlich und resultiert in
Vermeidungsverhalten.
Unser Gehirn macht uns also zu
Wiederholungstätern. Werden
wir deshalb Gewohnheiten wie
das Rauchen nur schwer wieder
los?
Nikotin ist bekanntlich eine Droge und
ebenso wie Alkohol und künstliche
Drogen wirkt es als Belohnungsstoff
außerordentlich viel stärker als die
Selbstbelohnungsstoffe des Gehirns.
Deshalb wird der Drang, das dadurch
Belohnte wieder zu tun oder wieder zu
erleben, übermächtig und damit zur
Sucht. Allerdings lässt die Wirkung oft
schnell nach und was bleibt, ist der
Entzugsschmerz, der dann über die
erneute Einnahme der Droge
vorübergehend gelindert wird. Eine
Sucht verstellt nachhaltig Netzwerke
im Belohnungssystem des Gehirns.
Daher ist sie nur sehr schwer zu
beseitigen.
Angenommen, wir haben die
angestrebten Veränderungen
erreicht – können wir uns denn
darauf verlassen, dass sie
Bestand haben werden?
Verhaltensmuster bleiben im Gehirn
grundsätzlich bestehen und werden
auch durch Verhaltensänderungen
niemals ausgelöscht, sondern nur
überlernt. Das ist immer eine
wackelige Sache – und unter
besonderen Belastungs- oder
Bedürfnisbedingungen fällt man
wieder in die alten Muster zurück.
Sie konnten zeigen, dass nur
zwanzig Prozent unserer
Persönlichkeit formbar sind –
welche sind das?
Dieser Wert bezieht sich auf die
Situation im Erwachsenenalter. Im
frühen Kindesalter ist vieles durch
frühe Erfahrungen und
Prägungserlebnisse veränderbar.
Unsere Persönlichkeit stabilisiert sich
zunehmend bis etwa zum sechzehnten
Lebensjahr. Danach haben wir nur
noch begrenzte
Veränderungsmöglichkeiten, die nicht
mehr den Kern unserer Persönlichkeit
betreffen. Der Aufwand, der für eine
Veränderung betrieben werden muss,
steigt zunehmend.
Uns zu verändern wird immer
unbequemer?
Persönlichkeitspsychologen sind der
Ansicht, dass wir uns ab dem späten
Jugendalter nicht mehr so sehr neuen
Lebensumständen anpassen, sondern
uns eher diejenigen Umstände suchen,
die zu unserer Persönlichkeit passen.
Umgekehrt heißt das: je früher
wir uns ändern, desto leichter
tun wir uns?
Es ist richtig, dass Änderungen in der
Persönlichkeit umso leichter erfolgen,
je früher sie geschehen – zum Teil
finden sie schon vorgeburtlich statt.
Allerdings vollzieht sich dies in der
Regel nicht aus freiem Willen, sondern
unter dem Einfluss der individuellen
und sozialen Umwelt, insbesondere der
frühkindlichen Bindungserfahrung.
Deshalb kann man nicht von einer
bewussten Veränderung sprechen.
Was ist der evolutionäre
Hintergedanke dabei, dass wir
uns gar nicht so stark selbst
formen können, wie wir das
vermutlich glauben?
Jede Gemeinschaft beruht auf einer
hohen Verlässlichkeit und
Vorausschaubarkeit des Verhaltens
ihrer Individuen. Unsere Gesellschaft
könnte nicht bestehen, wenn wir uns
alle jederzeit stark ändern würden – ob
nun aus innerem Antrieb oder
aufgrund äußerlicher Einflüsse. Junge
Menschen erlangen hinsichtlich ihrer
Persönlichkeit zunehmend eine
Stabilität des Handelns – wir nennen
das „Erwachsenwerden“. Genau das
bezwecken schließlich auch
gesellschaftliche Normen.
Sind wir so programmiert, dass
wir auf Veränderungen, die von
außen auf uns Einfluss nehmen,
am liebsten mit Anpassung
reagieren?
Veränderungen werden in der Tat
meist von außen angestoßen. Wir
folgen ihnen dann innerhalb des
weiten oder engen Rahmens, den
unsere Persönlichkeit vorgibt. Die
meisten Menschen verändern sich bei
Herausforderungen nur wenig, sie
versuchen, ihnen durch Ausweichen zu
entgehen, indem sie günstigere
Bedingungen suchen. Was nach
Anpassung aussieht, ist oft nur
Vermeidung.
Formt uns unser Umfeld stärker
als wir annehmen?
Das Ausmaß der Fähigkeit zur
Veränderung ist Teil unserer
Persönlichkeit: Während manche
Menschen Veränderungen lieben,
mögen die meisten keine allzu
tiefgreifenden. Es gibt allerdings auch
eine gewisse soziokulturelle Umwelt,
die Veränderungen unterstützt oder
erschwert. So sind US-Amerikaner
eher veränderungsgeneigt und
Deutsche eher veränderungsaversiv –
in beiden Fällen wohl aus
geschichtlichen Gründen.
Wie steht es denn um unsere
Vernunft – helfen gute
Argumente für Veränderungen?
Gute Argumente appellieren an
unseren Verstand, der ohne eine
bewusste oder unbewusste emotionale
Verstärkung keinen eigenen Einfluss
auf unser Verhalten hat. Und
schließlich handelt es sich auch nur um
unsere eigenen Argumente. Wir
glauben irrtmlicherweise, es gäbe eine
überindividuelle Ratio. Aber was dem
einen höchst einleuchtend vorkommt,
muss es einem anderen noch lange
nicht tun.
Ist das nicht ein
niederschmetternder Befund?
Nur bei oberflächlicher Betrachtung –
denn was uns am besten antreibt, ist
über Jahre oder Jahrzehnte erworbene
Erfahrung, die oft als Intuition oder
Gefühl vorliegt. Gedanken kommen
und gehen, unsere Erfahrung bleibt.
Tun sich neugierige oder
phantasievolle Menschen
eigentlich leichter damit,
Veränderungen anzustoßen?
Es gehört zum Naturell dieser offenen
Menschen, dass ihnen Veränderungen
grundsätzlich gefallen. Sie langweilen
sich aber auch schneller.
Und Empathie – kann man sie
trainieren oder erlernen?
Wir haben eine angeborene Neigung
zu Empathie. Sie muss aber durch die
frühkindliche Bindungserfahrung
bestärkt werden. Geschieht dies nicht,
kann man Empathie später nur noch
sehr begrenzt trainieren. Es wird zum
Beispiel bei Gewaltverbrechern
versucht, bleibt aber meist zwecklos.
Was ist davon zu halten, wenn
uns Freunde oder Kollegen
berichten, dass sie sich stark
verändert haben?
Das kommt auf die Gründe an.
Manche Menschen ändern sich
tatsächlich, weil sie tiefgreifende oder
langanhaltende langanhaltende
positive oder insbesondere negative
Erfahrungen gemacht haben. Die
meisten Menschen verwechseln aber
eine relativ oberflächliche
Veränderung – einen neuen Wohnort,
einen neuen Job oder einen neuen
Partner – mit Veränderungen in der
Struktur ihrer Persönlichkeit. Die
ändert sich im Erwachsenenalter nur
schwer und langsam.
Gibt es ideale Voraussetzungen,
damit positive und nachhaltige
Veränderungen geschehen?
Es gibt im Grunde nur zwei
Bedingungen für eine tiefgreifende
Veränderung unserer Persönlichkeit.
Ein schockartiges Erlebnis, das uns zur
Umkehr bringt, oder jahrelange
Einwirkungen von irgendwo her –
meist vom Partner. Aber auch das
funktioniert nicht verlässlich, denn ein
jahrelang nörgelndes Gegenüber kann
einen schließlich auch dazu bringen,
die Koffer zu packen.
Das schockartige Erlebnis würde
immerhin die biblische
Geschichte erklären, wie aus
Saulus auf einmal Paulus
wurde...
Saulus war allem Anschein nach
Epileptiker und hatte einen „großen
Anfall“ vor Damaskus. Dazu passt der
in der Apostelgeschichte überlieferte
Bericht einer Erscheinung mit Stimme
– die meisten Propheten aller
Offenbarungsreligionen berichten
davon.
Eine derartige Erscheinung lsst
sich wissenschaftlich
beschreiben? Ja. In der
Großhirnrinde fallen hemmende
Mechanismen, die sogenannten
inhibitorischen Nervenzellen, aus und
es kommt zu einem regelrechten
Erregungssturm. Das kann auch lokal
geschehen, beispielsweise im rechten
Schläfenlappen, wo Nervennetze
lokalisiert sind, die mit Empathie,
Bindung und starken, oft religiösen
Gefühlen, mit Erleuchtung, Ekstase
und visuellen und auditorischen
Halluzinationen zu tun haben. Wird
dort starke Erregung ausgelöst, kommt
es bei Persönlichkeiten, die schon
zuvor sehr religiös orientiert waren, zu
Offenbarungshalluzinationen. Das
Ganze kann sich auch bei sensorischer
Isolation ergeben – wenn also „heilige
Männer“ lange völlig zurückgezogen in
der Wüste leben. Sensorische Isolation
bringt die Eigenaktivität des Gehirns
zum überborden.
Erst wenn es gar nicht mehr
anders geht, wachen wir auf und
verändern uns. Können Sie als
Hirnforscher dieser These
zustimmen?
Ja! Die meisten Menschen ändern sich
nur, wenn ihnen die „Schiete bis zum
Hals steht“ – Leidensdruck ist sehr
wichtig für Veränderungen.
Heißt das, Krisenzeiten sind gute
Zeiten, um Veränderungen in
Gang zu bringen?
Wahrscheinlich, obwohl uns das nicht
besonders gefällt. Politisch-
gesellschaftliche Krisenzeiten waren
meist kulturelle und intellektuelle
Blütezeiten – beispielsweise die
Weimarer Republik vor den Nazis. Die
Menschen werden dann stärker mit
Herausforderungen konfrontiert.
Neurowissenschaftlich
betrachtet: Wo würden Sie
ansetzen, wenn Sie die politische
Gestaltungsmacht hätten?
Ich würde in der Früherziehung der
Kinder und in der Schule ansetzen,
denn dort können Menschen sich noch
gut entwickeln. Gerade junge
Menschen sollten heute offener und
toleranter, neugieriger und
selbstbestimmter werden. Und
verantwortungsvoller. Viele Deutsche
hängen zu sehr an den
Dienstleistungen des Sozialstaats und
fürchten sich vor Veränderungen –
was man gerade drastisch sieht.
Insgesamt muss man dagegen etwas
tun, denn Veränderungsangst lähmt
das Denken und die Kreativität. •
Quelle: Das Magazin der Grünen –
Mitgliederzeitschrift für bündnisgrüne Politik Nr.
1, ISSN 1434-3835
GERHARD ROTH ist Neurobiologe und
Hirnforscher an der Universität Bremen.
Fr seine Verdienste in der
Wissenschaft und die
Förderung von Schülern aus
bildungsfernen Elternhusern
wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz
verliehen.





































