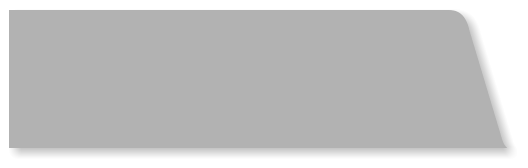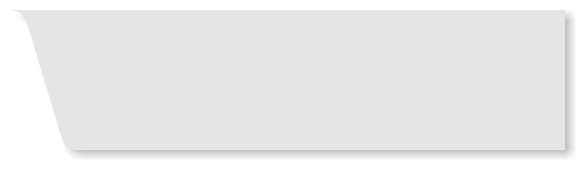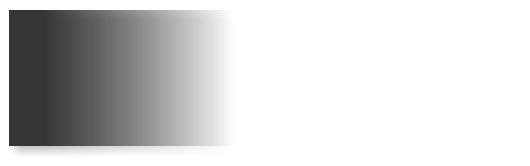Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
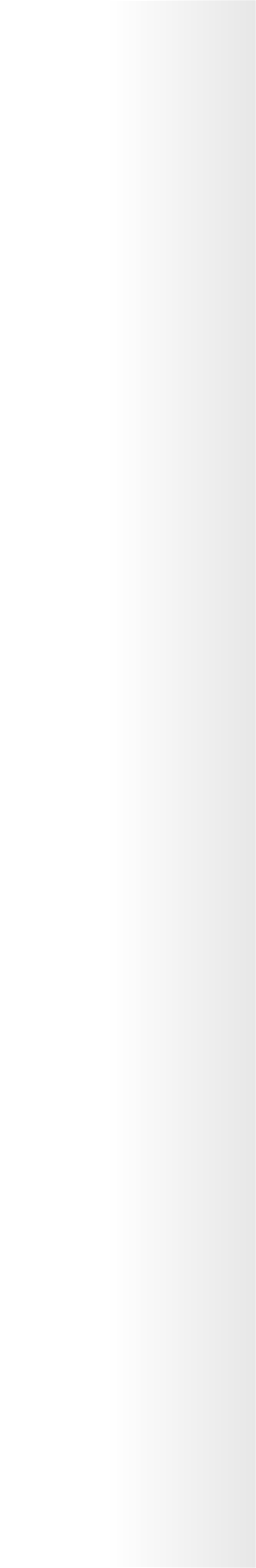
MICHAEL E. MANN
55, ist Professor für Atmosphärenwissenschaften an der
Pennsylvania State University.
DIE ZEIT: Professor Mann, wegen Ihrer Forschung mussten Sie schon einiges
erdulden, bis hin zu Morddrohungen. In Ihrem aktuellen Buch schreiben Sie aber,
dass die aggressiven Leugner des Klimawandels allmählich verschwänden. Dafür
gebe es neue Gegner: die "Tatenlosen". Sind die nicht vergleichsweise harmlos?
Michael E. Mann: Die Gegner in diesem neuen Klimakrieg können den
Klimawandel nicht mehr einfach so leugnen, weil seine Auswirkungen –
Hitzewellen, Dürren, Buschbrände, Überschwemmungen – überall auf der Welt
sichtbar sind. Deshalb versuchen sie, uns mit einer Vielzahl hinterlistiger
Taktiken zu verwirren und abzulenken. Es sind Petrostaaten wie Russland und
Saudi-Arabien und mächtige Energiekonzerne, die nicht wollen, dass wir uns von
fossilen Brennstoffen befreien. Dazu kommen Organisationen und Gruppen, die
von ihnen finanziert werden, sowie Politiker, Medien und Persönlichkeiten, die
sich als ihre Fürsprecher betätigen. Ich nenne sie Tatenlose, weil sie die
Klimakrise kleinreden oder falsche Lösungen wie Geo-Engineering propagieren,
die unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern nicht verringern würden.
Außerdem lenken sie uns von großen, systemverändernden Lösungen ab, indem
sie den Fokus auf unser individuelles Verhalten richten. Als ob es auf
Einzelpersonen ankäme.
ZEIT: Tut es das nicht?
Mann: Es ist ein Ablenkungsmanöver. Eine Taktik, um Druck von den Politikern zu
nehmen, die den Klimawandel mit gesetzlichen Mitteln bekämpfen sollten.
Schauen Sie, der gesamte Flugverkehr trägt etwa drei Prozent zu den globalen
Treibhausgas-Emissionen bei. Sechs Prozent werden durch den Verzehr von
Rindfleisch erzeugt. Aber gut 70 Prozent der menschengemachten Kohlendioxid-
Emissionen lassen sich auf rund hundert Kohle-, Öl- und Gaskonzerne weltweit
zurückführen.
ZEIT: Aber was spricht denn dagegen, wenn jemand dem Klima zuliebe auf
Flugreisen oder Fleisch verzichtet?
Mann: Nichts! Genau deshalb treffen die Tatenlosen da einen Punkt, der für sich
genommen sehr vernünftig ist. Natürlich sollten wir im Alltag all diese Dinge
tun, die der Umwelt helfen, warum auch nicht? Sie sparen uns Geld, sie machen
uns gesünder, sie tragen dazu bei, dass wir uns besser fühlen. Aber wir dürfen
nicht zulassen, dass uns das als Lösung für die Klimakrise verkauft wird. Denn
weder Sie noch ich können einen Preis für Kohlendioxid festlegen. Oder Anreize
schaffen, um erneuerbare Energien zu fördern. Oder verhindern, dass eine neue
Öl- oder Gas-Pipeline gebaut wird. Das sind Dinge, die nur Politikerinnen und
Politiker tun können. Wir brauchen einen systemischen Wandel, der uns alle
gemeinsam von den fossilen Energien wegbringt.
ZEIT: In Ihrem Buch formulieren Sie es etwas spitzer. Über diesen Satz musste
ich lachen: "Wenn Klima-Aktivisten fernab des Netzes leben müssten, nur essen
dürften, was sie selber anbauen können, und nur Kleidung tragen dürften, die
sie selbst gestrickt haben, dann gäbe es keine nennenswerte Klima-Bewegung."
Mann: Vielen Dank. Das war eine ernsthafte Aussage von meiner Seite. Ich will
bestimmt niemanden lächerlich machen, der Entscheidungen für sein eigenes
Leben trifft. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir innerhalb des Systems tätig
werden müssen, um das System zu verändern.
ZEIT: Trotzdem werden Sie neuerdings nicht mehr nur von der Erdöl-Lobby
angegriffen, sondern auch von linken Aktivisten, die sich über Ihre Aussagen
etwa zum Fleischkonsum empören. Wie reagieren Sie darauf?
Mann: Das ist eine echte Herausforderung, vor allem in den sozialen Medien, die
von den Tatenlosen benutzt werden, um Konflikte anzuheizen und die Leute
dazu zu bringen, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Ich tue mein Bestes, um
klar zu kommunizieren. Wissen Sie, ich esse selbst kein Fleisch, wir haben ein
elektrisches Fahrzeug, und wir beziehen unsere gesamte Energie aus
erneuerbaren Quellen. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die mir
vorwerfen, ich würde all diese Dinge nur sagen, weil ich nicht auf Hamburger
verzichten wolle. Darauf kann ich nur antworten: Ich tue mein Möglichstes, um
die Umwelt zu schonen. Wir können natürlich versuchen, was Gandhi gefordert
hat: die Veränderung zu sein, die wir in der Welt sehen wollen. Aber Individuen
spielen vor allem dann eine relevante Rolle, wenn sie gemeinsam handeln,
wählen gehen und politisches Handeln fordern.
ZEIT: Wie genau verhindert die fossile Energielobby, dass das geschieht?
Mann: Sie greift auf bewährte Taktiken zurück, die auf ähnliche Weise auch von
der Tabakindustrie oder von der Waffenlobby verwendet wurden. In den USA
wehrte sich die Waffenlobby gegen schärfere Waffengesetze mit dem Slogan:
"Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen". Heute verwenden
die Profiteure im Umfeld der Kohle-, Öl- und Gaskonzerne ein ähnliches
Drehbuch. Das Konzept des "persönlichen CO₂-Fußabdrucks" zum Beispiel wurde
in den 2000er-Jahren in den USA vor allem vom Energiekonzern BP populär
gemacht.
ZEIT: Tatsächlich? Der persönliche CO₂-Fußabdruck ist ja ein häufig verwendetes
Maß für die Kohlendioxid-Emissionen, die ein Mensch im Alltag verursacht, etwa
durch seine Ernährung, Heizen oder Autofahren.
Mann: Richtig. Die Produzenten fossiler Brennstoffe wollen nicht, dass wir auf
ihren CO₂-Fußabdruck schauen, darum sollen wir auf unseren eigenen schauen.
So sind wir beschäftigt und drängen nicht darauf, dass dringend nötige
Maßnahmen ergriffen werden, um das Klima zu stabilisieren. Das ist vielleicht
meine wichtigste Botschaft: Wir sind so nah dran. Wir sehen, was zu tun ist, es
gibt messbare Fortschritte. Die Tatenlosen sind das einzige wirkliche Hindernis,
das uns im Weg steht. Deshalb ist es so wichtig, sie zu benennen: damit wir uns
gegen sie verteidigen können. BP ist ein besonderes Beispiel, weil das
Unternehmen mit seiner Verschleierungstaktik so erfolgreich war. Aber es war
bei Weitem nicht der Einzige.
ZEIT: Warum funktioniert dieser Trick immer noch so gut?
Mann: Gute Frage. Das "Greenwashing" der Unternehmen ist sehr erfolgreich.
Ihre Strategie ist, sich in ihren Werbekampagnen als umweltbewusst
darzustellen, während sie hinter den Kulissen Organisationen und Politiker
unterstützen, die das Gegenteil von Klimaschutz im Sinn haben. Ein historisches
Vorbild dafür ist in den USA die Kampagne mit dem "weinenden Indianer", der
sogar zahlreiche Umweltschutzorganisationen auf den Leim gegangen sind.
ZEIT: Wie das?
Mann: Es war ein wirklich fesselnder Werbespot, der in den Siebzigerjahren
ständig ausgestrahlt wurde. Ich war noch klein, aber ich erinnere mich genau:
Ein Ureinwohner in traditioneller Kleidung paddelt in seinem Kanu durch eine
schrecklich vermüllte Landschaft; über seine Wange rinnt eine Träne. Dazu eine
Stimme aus dem Off: "Menschen beginnen die Verschmutzung. Menschen können
sie stoppen." Als Kind war ich tief bewegt. Aber der Werbespot war ein einziges
Täuschungsmanöver – selbst der Schauspieler war kein Ureinwohner, sondern
italienischer Abstammung. Hinter der Kampagne steckte die Getränke-Industrie.
Sie wollte ein Gesetz stoppen, das sie dazu verpflichtet hätte, Flaschen und
Dosen zurückzunehmen und zu recyceln. Es wäre eine effektive, umfassende
Lösung gewesen, um Plastikmüll zu reduzieren, aber es hätte die Hersteller
Geld gekostet. Deshalb überzeugten sie die Amerikanerinnen und Amerikaner,
dass man Plastikmüll einfach nur aufsammeln und wegschmeißen müsse. Wir
können der Getränke-Industrie dafür danken, dass wir nun auch dieses andere
globale Problem haben: Plastikmüll in den Ozeanen.
ZEIT: Apropos effektive Lösungen: Was erwarten Sie in Sachen Klimapolitik von
Joe Biden?
Mann: Wir haben jetzt eine Regierung, die präsidiale Dekrete zur Bewältigung
der Klimakrise unterstützt. Aber wir brauchen immer noch Gesetze, wir
brauchen den Kongress, und das wird auch in Zukunft ein Kampf bleiben. Wir
müssen unsere Wirtschaft so umstrukturieren, dass es keine Anreize mehr gibt,
in fossile Energien zu investieren. Sonst haben wir keine Chance, den Ausstoß
von Treibhausgasen innerhalb der nächsten zehn Jahre so zu reduzieren, wie wir
es tun müssen.
ZEIT: Wie kann das gelingen?
Mann: Wir brauchen kein Wunder, weil wir die Lösung längst haben:
Solarenergie, Windkraft, Erdwärme. Es gibt inzwischen eine Fülle von Literatur,
die zeigt, dass wir es schaffen können, die Wirtschaft mit existierenden
Technologien bis 2030 um 80 Prozent zu dekarbonisieren, bis 2050 sogar
vollständig. Da sind technische Fortschritte bei den erneuerbaren Energien noch
nicht einmal einkalkuliert.
"Wir können das Schlimmste abwenden"
ZEIT: Das klingt jetzt sehr optimistisch.
Mann: Nun, man kann das Glas immer als halb voll oder als halb leer sehen.
Natürlich können Sie auf Katastrophen verweisen, die sich vor unseren Augen
abspielen, und zeigen, dass der Klimawandel bereits eine gefährliche Phase
erreicht hat. Mein Punkt ist, dass wir das Schlimmste abwenden können – jene
Art von Klimawandel, der die menschliche Zivilisation gefährden könnte. Viele
dieser Untergangsszenarios, die etwa Autoren wie Jonathan Franzen oder David
Wallace-Wells beschreiben, basieren auf einer Verzerrung der Klimaforschung,
die in mancher Hinsicht so schlimm ist wie die Verzerrungen der Klimaleugner.
Dass zum Beispiel das ganze Methan, das in der Arktis gespeichert war, auf
einmal in die Atmosphäre entweicht und den Planeten schlagartig aufheizt.
Manche Untergangsdichter behaupten ja sogar, dass deshalb alles Leben auf der
Erde innerhalb von zehn Jahren ausgelöscht werde. Übrigens ist diese
Behauptung fünf Jahre alt, das sollten Sie sich also in Ihren Kalender eintragen.
ZEIT: Den Weltuntergang in fünf Jahren?
Mann: Solche Untergangsszenarios sind Unsinn. Sie gründen auf schlechter
Wissenschaft.
ZEIT: Neben den Leugnern und den Poeten des Untergangs gibt es noch eine
weitere Spezies, die Ihre Streitlust zu wecken scheint: die "first-time climate
dudes", übersetzt ungefähr "erstmalige Klima-Kerle". Den Begriff müssen Sie
erklären.
Mann: Ist er nicht großartig? Leider ist er nicht von mir, sondern von einer
Journalistin, die ich zitiere. Gemeint sind ältere weiße Männer. Wir sind eine
privilegierte Gruppe. Uns eint die Überzeugung, wir hätten die Lösungen für alle
Probleme und die anderen bräuchten bloß auf uns zu hören.
ZEIT: Bill Gates, der ebenfalls ein Buch über den Klimawandel veröffentlicht
hat, sei ein klassischer Fall, schreiben Sie.
Mann: Bill Gates hat in der Klima-Debatte früher eine wenig konstruktive Rolle
gespielt, aber ich denke, dass er sich in eine konstruktivere Richtung bewegt. Er
scheint jetzt zu begreifen, dass wir staatliche Interventionen benötigen, dass
wir es also nicht dem Markt überlassen können, die Klimakrise zu lösen. Aber er
redet immer noch klein, welche Rolle die erneuerbaren Energien dabei spielen –
mit den üblichen Argumenten, die in weiten Teilen widerlegt sind. Und dann
sucht er Lösungen, die meiner Meinung nach eher trügerisch sind, wie Geo-
Engineering oder Atomkraft. Ich denke, dass er das Herz am richtigen Fleck hat.
Aber er erreicht so viele Menschen, und die bekommen jetzt alle einen ziemlich
kurzsichtigen Vorschlag zur Lösung der Klimakrise serviert.
ZEIT: Noch beschäftigt uns ja eine andere Krise. Können wir aus der Pandemie
etwas lernen, das uns bei der Bewältigung der Klimakrise hilft?
Mann: Oh ja. Die Pandemie ist eine Lektion über unseren Platz auf diesem
Planeten, über Verwundbarkeit und Nachhaltigkeit, darüber, wie tödlich
Wissenschaftsfeindlichkeit sein kann. Die Pandemie hat dazu beigetragen, den
Weg für eine gute Klimapolitik frei zu machen. Ich bin optimistisch, dass wir die
Gelegenheit für einen besseren Wiederaufbau der Wirtschaft nutzen; so lautet
ja auch das Motto der Biden-Administration. Besser heißt: grüner. In den USA
gibt es Hinweise darauf, dass das nun geschieht, nicht zuletzt dank des Corona-
Hilfspakets. Dazu kommt die weltweite Jugend-Klimabewegung, die uns daran
erinnert, dass wir eine ethische Verpflichtung haben, den Planeten nicht zu
zerstören. Außerdem sehen und fühlen die Menschen längst, was Klimawandel
ist. All diese Faktoren kommen in einem Moment zusammen, in dem sich in der
amerikanischen Politik der Wind dreht. Historisch betrachtet sind wir
Amerikaner ja der größte Verursacher von Treibhausgasen, deshalb war es
schwierig zu vermitteln, warum der Rest der Welt handeln sollte, wenn wir
nicht mitmachen. Aber wir sind wieder da. Und bei Bidens Klimagipfel in diesem
Monat werden hoffentlich auch andere an Bord kommen, sodass wir bei der
Klimakonferenz in Glasgow im November weltweit deutlich ehrgeizigere Ziele
beim Reduzieren von Klimagasen sehen werden.
Quelle: https://www.zeit.de/2021/16/michael-e-mann-klimakrise-treibhausgas-emmissionen-erdoel-
lobby-fleischkonsum/komplettansicht
Manns Buch "Propagandaschlacht ums Klima: Wie wir die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit
besiegen" erschien im März im Verlag Solare Zukunft.

Michael E. Mann:
"Wir sind so nah dran"
Die Klimakrise sei lösbar, sagt der US-Klimaforscher Michael E. Mann –
aber die Erdöl-Lobby kopiere die Abwehrmethoden der Tabakindustrie.
Interview: Samiha Shafy


MICHAEL E. MANN
55, ist Professor für Atmosphärenwissenschaften
an der Pennsylvania State University.
DIE ZEIT: Professor Mann, wegen Ihrer
Forschung mussten Sie schon einiges
erdulden, bis hin zu Morddrohungen. In
Ihrem aktuellen Buch schreiben Sie aber,
dass die aggressiven Leugner des
Klimawandels allmählich verschwänden.
Dafür gebe es neue Gegner: die
"Tatenlosen". Sind die nicht
vergleichsweise harmlos?
Michael E. Mann: Die Gegner in diesem
neuen Klimakrieg können den
Klimawandel nicht mehr einfach so
leugnen, weil seine Auswirkungen –
Hitzewellen, Dürren, Buschbrände,
Überschwemmungen – überall auf der
Welt sichtbar sind. Deshalb versuchen sie,
uns mit einer Vielzahl hinterlistiger
Taktiken zu verwirren und abzulenken. Es
sind Petrostaaten wie Russland und Saudi-
Arabien und mächtige Energiekonzerne,
die nicht wollen, dass wir uns von fossilen
Brennstoffen befreien. Dazu kommen
Organisationen und Gruppen, die von
ihnen finanziert werden, sowie Politiker,
Medien und Persönlichkeiten, die sich als
ihre Fürsprecher betätigen. Ich nenne sie
Tatenlose, weil sie die Klimakrise
kleinreden oder falsche Lösungen wie
Geo-Engineering propagieren, die unsere
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
nicht verringern würden. Außerdem
lenken sie uns von großen,
systemverändernden Lösungen ab, indem
sie den Fokus auf unser individuelles
Verhalten richten. Als ob es auf
Einzelpersonen ankäme.
ZEIT: Tut es das nicht?
Mann: Es ist ein Ablenkungsmanöver. Eine
Taktik, um Druck von den Politikern zu
nehmen, die den Klimawandel mit
gesetzlichen Mitteln bekämpfen sollten.
Schauen Sie, der gesamte Flugverkehr
trägt etwa drei Prozent zu den globalen
Treibhausgas-Emissionen bei. Sechs
Prozent werden durch den Verzehr von
Rindfleisch erzeugt. Aber gut 70 Prozent
der menschengemachten Kohlendioxid-
Emissionen lassen sich auf rund hundert
Kohle-, Öl- und Gaskonzerne weltweit
zurückführen.
ZEIT: Aber was spricht denn dagegen,
wenn jemand dem Klima zuliebe auf
Flugreisen oder Fleisch verzichtet?
Mann: Nichts! Genau deshalb treffen die
Tatenlosen da einen Punkt, der für sich
genommen sehr vernünftig ist. Natürlich
sollten wir im Alltag all diese Dinge tun,
die der Umwelt helfen, warum auch nicht?
Sie sparen uns Geld, sie machen uns
gesünder, sie tragen dazu bei, dass wir uns
besser fühlen. Aber wir dürfen nicht
zulassen, dass uns das als Lösung für die
Klimakrise verkauft wird. Denn weder Sie
noch ich können einen Preis für
Kohlendioxid festlegen. Oder Anreize
schaffen, um erneuerbare Energien zu
fördern. Oder verhindern, dass eine neue
Öl- oder Gas-Pipeline gebaut wird. Das
sind Dinge, die nur Politikerinnen und
Politiker tun können. Wir brauchen einen
systemischen Wandel, der uns alle
gemeinsam von den fossilen Energien
wegbringt.
ZEIT: In Ihrem Buch formulieren Sie es
etwas spitzer. Über diesen Satz musste ich
lachen: "Wenn Klima-Aktivisten fernab des
Netzes leben müssten, nur essen dürften,
was sie selber anbauen können, und nur
Kleidung tragen dürften, die sie selbst
gestrickt haben, dann gäbe es keine
nennenswerte Klima-Bewegung."
Mann: Vielen Dank. Das war eine
ernsthafte Aussage von meiner Seite. Ich
will bestimmt niemanden lächerlich
machen, der Entscheidungen für sein
eigenes Leben trifft. Ich will nur darauf
hinweisen, dass wir innerhalb des Systems
tätig werden müssen, um das System zu
verändern.
ZEIT: Trotzdem werden Sie neuerdings
nicht mehr nur von der Erdöl-Lobby
angegriffen, sondern auch von linken
Aktivisten, die sich über Ihre Aussagen
etwa zum Fleischkonsum empören. Wie
reagieren Sie darauf?
Mann: Das ist eine echte Herausforderung,
vor allem in den sozialen Medien, die von
den Tatenlosen benutzt werden, um
Konflikte anzuheizen und die Leute dazu
zu bringen, mit dem Finger aufeinander zu
zeigen. Ich tue mein Bestes, um klar zu
kommunizieren. Wissen Sie, ich esse
selbst kein Fleisch, wir haben ein
elektrisches Fahrzeug, und wir beziehen
unsere gesamte Energie aus erneuerbaren
Quellen. Trotzdem gibt es immer wieder
Leute, die mir vorwerfen, ich würde all
diese Dinge nur sagen, weil ich nicht auf
Hamburger verzichten wolle. Darauf kann
ich nur antworten: Ich tue mein
Möglichstes, um die Umwelt zu schonen.
Wir können natürlich versuchen, was
Gandhi gefordert hat: die Veränderung zu
sein, die wir in der Welt sehen wollen.
Aber Individuen spielen vor allem dann
eine relevante Rolle, wenn sie gemeinsam
handeln, wählen gehen und politisches
Handeln fordern.
ZEIT: Wie genau verhindert die fossile
Energielobby, dass das geschieht?
Mann: Sie greift auf bewährte Taktiken
zurück, die auf ähnliche Weise auch von
der Tabakindustrie oder von der
Waffenlobby verwendet wurden. In den
USA wehrte sich die Waffenlobby gegen
schärfere Waffengesetze mit dem Slogan:
"Waffen töten keine Menschen, Menschen
töten Menschen". Heute verwenden die
Profiteure im Umfeld der Kohle-, Öl- und
Gaskonzerne ein ähnliches Drehbuch. Das
Konzept des "persönlichen CO₂-
Fußabdrucks" zum Beispiel wurde in den
2000er-Jahren in den USA vor allem vom
Energiekonzern BP populär gemacht.
ZEIT: Tatsächlich? Der persönliche CO₂-
Fußabdruck ist ja ein häufig verwendetes
Maß für die Kohlendioxid-Emissionen, die
ein Mensch im Alltag verursacht, etwa
durch seine Ernährung, Heizen oder
Autofahren.
Mann: Richtig. Die Produzenten fossiler
Brennstoffe wollen nicht, dass wir auf
ihren CO₂-Fußabdruck schauen, darum
sollen wir auf unseren eigenen schauen.
So sind wir beschäftigt und drängen nicht
darauf, dass dringend nötige Maßnahmen
ergriffen werden, um das Klima zu
stabilisieren. Das ist vielleicht meine
wichtigste Botschaft: Wir sind so nah
dran. Wir sehen, was zu tun ist, es gibt
messbare Fortschritte. Die Tatenlosen sind
das einzige wirkliche Hindernis, das uns
im Weg steht. Deshalb ist es so wichtig,
sie zu benennen: damit wir uns gegen sie
verteidigen können. BP ist ein besonderes
Beispiel, weil das Unternehmen mit seiner
Verschleierungstaktik so erfolgreich war.
Aber es war bei Weitem nicht der Einzige.
ZEIT: Warum funktioniert dieser Trick
immer noch so gut?
Mann: Gute Frage. Das "Greenwashing" der
Unternehmen ist sehr erfolgreich. Ihre
Strategie ist, sich in ihren
Werbekampagnen als umweltbewusst
darzustellen, während sie hinter den
Kulissen Organisationen und Politiker
unterstützen, die das Gegenteil von
Klimaschutz im Sinn haben. Ein
historisches Vorbild dafür ist in den USA
die Kampagne mit dem "weinenden
Indianer", der sogar zahlreiche
Umweltschutzorganisationen auf den Leim
gegangen sind.
ZEIT: Wie das?
Mann: Es war ein wirklich fesselnder
Werbespot, der in den Siebzigerjahren
ständig ausgestrahlt wurde. Ich war noch
klein, aber ich erinnere mich genau: Ein
Ureinwohner in traditioneller Kleidung
paddelt in seinem Kanu durch eine
schrecklich vermüllte Landschaft; über
seine Wange rinnt eine Träne. Dazu eine
Stimme aus dem Off: "Menschen beginnen
die Verschmutzung. Menschen können sie
stoppen." Als Kind war ich tief bewegt.
Aber der Werbespot war ein einziges
Täuschungsmanöver – selbst der
Schauspieler war kein Ureinwohner,
sondern italienischer Abstammung. Hinter
der Kampagne steckte die Getränke-
Industrie. Sie wollte ein Gesetz stoppen,
das sie dazu verpflichtet hätte, Flaschen
und Dosen zurückzunehmen und zu
recyceln. Es wäre eine effektive,
umfassende Lösung gewesen, um
Plastikmüll zu reduzieren, aber es hätte
die Hersteller Geld gekostet. Deshalb
überzeugten sie die Amerikanerinnen und
Amerikaner, dass man Plastikmüll einfach
nur aufsammeln und wegschmeißen
müsse. Wir können der Getränke-Industrie
dafür danken, dass wir nun auch dieses
andere globale Problem haben:
Plastikmüll in den Ozeanen.
ZEIT: Apropos effektive Lösungen: Was
erwarten Sie in Sachen Klimapolitik von
Joe Biden?
Mann: Wir haben jetzt eine Regierung, die
präsidiale Dekrete zur Bewältigung der
Klimakrise unterstützt. Aber wir brauchen
immer noch Gesetze, wir brauchen den
Kongress, und das wird auch in Zukunft
ein Kampf bleiben. Wir müssen unsere
Wirtschaft so umstrukturieren, dass es
keine Anreize mehr gibt, in fossile
Energien zu investieren. Sonst haben wir
keine Chance, den Ausstoß von
Treibhausgasen innerhalb der nächsten
zehn Jahre so zu reduzieren, wie wir es
tun müssen.
ZEIT: Wie kann das gelingen?
Mann: Wir brauchen kein Wunder, weil wir
die Lösung längst haben: Solarenergie,
Windkraft, Erdwärme. Es gibt inzwischen
eine Fülle von Literatur, die zeigt, dass
wir es schaffen können, die Wirtschaft mit
existierenden Technologien bis 2030 um 80
Prozent zu dekarbonisieren, bis 2050 sogar
vollständig. Da sind technische
Fortschritte bei den erneuerbaren
Energien noch nicht einmal einkalkuliert.
"Wir können das Schlimmste abwenden"
ZEIT: Das klingt jetzt sehr optimistisch.
Mann: Nun, man kann das Glas immer als
halb voll oder als halb leer sehen.
Natürlich können Sie auf Katastrophen
verweisen, die sich vor unseren Augen
abspielen, und zeigen, dass der
Klimawandel bereits eine gefährliche
Phase erreicht hat. Mein Punkt ist, dass
wir das Schlimmste abwenden können –
jene Art von Klimawandel, der die
menschliche Zivilisation gefährden
könnte. Viele dieser Untergangsszenarios,
die etwa Autoren wie Jonathan Franzen
oder David Wallace-Wells beschreiben,
basieren auf einer Verzerrung der
Klimaforschung, die in mancher Hinsicht
so schlimm ist wie die Verzerrungen der
Klimaleugner. Dass zum Beispiel das ganze
Methan, das in der Arktis gespeichert war,
auf einmal in die Atmosphäre entweicht
und den Planeten schlagartig aufheizt.
Manche Untergangsdichter behaupten ja
sogar, dass deshalb alles Leben auf der
Erde innerhalb von zehn Jahren
ausgelöscht werde. Übrigens ist diese
Behauptung fünf Jahre alt, das sollten Sie
sich also in Ihren Kalender eintragen.
ZEIT: Den Weltuntergang in fünf Jahren?
Mann: Solche Untergangsszenarios sind
Unsinn. Sie gründen auf schlechter
Wissenschaft.
ZEIT: Neben den Leugnern und den Poeten
des Untergangs gibt es noch eine weitere
Spezies, die Ihre Streitlust zu wecken
scheint: die "first-time climate dudes",
übersetzt ungefähr "erstmalige Klima-
Kerle". Den Begriff müssen Sie erklären.
Mann: Ist er nicht großartig? Leider ist er
nicht von mir, sondern von einer
Journalistin, die ich zitiere. Gemeint sind
ältere weiße Männer. Wir sind eine
privilegierte Gruppe. Uns eint die
Überzeugung, wir hätten die Lösungen für
alle Probleme und die anderen bräuchten
bloß auf uns zu hören.
ZEIT: Bill Gates, der ebenfalls ein Buch
über den Klimawandel veröffentlicht hat,
sei ein klassischer Fall, schreiben Sie.
Mann: Bill Gates hat in der Klima-Debatte
früher eine wenig konstruktive Rolle
gespielt, aber ich denke, dass er sich in
eine konstruktivere Richtung bewegt. Er
scheint jetzt zu begreifen, dass wir
staatliche Interventionen benötigen, dass
wir es also nicht dem Markt überlassen
können, die Klimakrise zu lösen. Aber er
redet immer noch klein, welche Rolle die
erneuerbaren Energien dabei spielen – mit
den üblichen Argumenten, die in weiten
Teilen widerlegt sind. Und dann sucht er
Lösungen, die meiner Meinung nach eher
trügerisch sind, wie Geo-Engineering oder
Atomkraft. Ich denke, dass er das Herz am
richtigen Fleck hat. Aber er erreicht so
viele Menschen, und die bekommen jetzt
alle einen ziemlich kurzsichtigen
Vorschlag zur Lösung der Klimakrise
serviert.
ZEIT: Noch beschäftigt uns ja eine andere
Krise. Können wir aus der Pandemie etwas
lernen, das uns bei der Bewältigung der
Klimakrise hilft?
Mann: Oh ja. Die Pandemie ist eine
Lektion über unseren Platz auf diesem
Planeten, über Verwundbarkeit und
Nachhaltigkeit, darüber, wie tödlich
Wissenschaftsfeindlichkeit sein kann. Die
Pandemie hat dazu beigetragen, den Weg
für eine gute Klimapolitik frei zu machen.
Ich bin optimistisch, dass wir die
Gelegenheit für einen besseren
Wiederaufbau der Wirtschaft nutzen; so
lautet ja auch das Motto der Biden-
Administration. Besser heißt: grüner. In
den USA gibt es Hinweise darauf, dass das
nun geschieht, nicht zuletzt dank des
Corona-Hilfspakets. Dazu kommt die
weltweite Jugend-Klimabewegung, die uns
daran erinnert, dass wir eine ethische
Verpflichtung haben, den Planeten nicht
zu zerstören. Außerdem sehen und fühlen
die Menschen längst, was Klimawandel ist.
All diese Faktoren kommen in einem
Moment zusammen, in dem sich in der
amerikanischen Politik der Wind dreht.
Historisch betrachtet sind wir Amerikaner
ja der größte Verursacher von
Treibhausgasen, deshalb war es schwierig
zu vermitteln, warum der Rest der Welt
handeln sollte, wenn wir nicht
mitmachen. Aber wir sind wieder da. Und
bei Bidens Klimagipfel in diesem Monat
werden hoffentlich auch andere an Bord
kommen, sodass wir bei der
Klimakonferenz in Glasgow im November
weltweit deutlich ehrgeizigere Ziele beim
Reduzieren von Klimagasen sehen werden.
Quelle: https://www.zeit.de/2021/16/michael-e-
mann-klimakrise-treibhausgas-emmissionen-erdoel-
lobby-fleischkonsum/komplettansicht
Manns Buch "Propagandaschlacht ums Klima: Wie
wir die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit
besiegen" erschien im März im Verlag Solare
Zukunft.

Michael E. Mann:
"Wir sind so nah dran"
Die Klimakrise sei lösbar, sagt der US-
Klimaforscher Michael E. Mann – aber
die Erdöl-Lobby kopiere die
Abwehrmethoden der Tabakindustrie.
Interview: Samiha Shafy