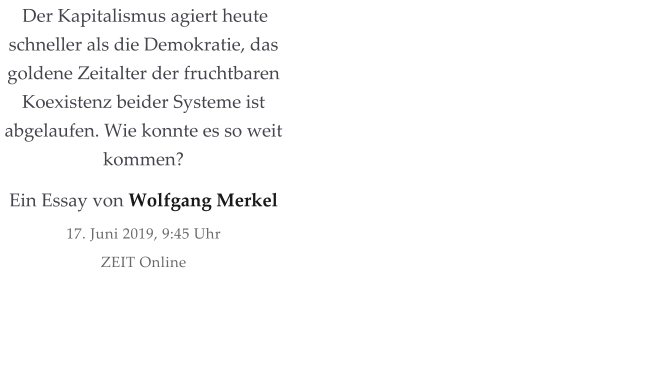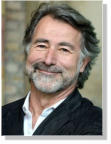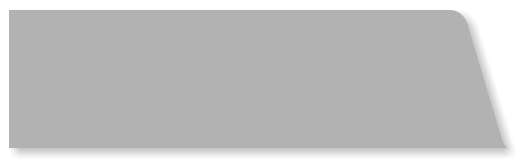
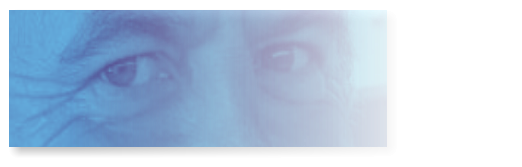

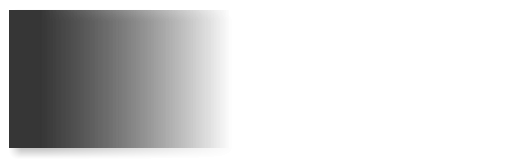
Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome
Kapitalismus: Aus dem Gleichgewicht
"Das Finanzkapital ist auf den Fahrersitz gesetzt worden" (George Soros 1998) © Bobby Yip/Reuters
Aus dem Gleichgewicht
Wolfgang Merkel ist Direktor der Forschungsabteilung Demokratie und Demokratisierung
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professor für
Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Kapitalismus und Demokratie sind heute höher entwickelt denn je. Gleichzeitig sind sie
fragiler und verwundbarer geworden. Die Balance zwischen Politik und Ökonomie ist aus
dem Gleichgewicht geraten. Ein Rückblick auf die Entwicklung und drei Thesen sollen
verdeutlichen, wie es dazu kam.
Als 1989 die diktatorischen Regime des Sowjetkommunismus zu kippen begannen, schrieb
ein noch unbekannter Angestellter des State Departments der Vereinigten Staaten von
Amerika einen Essay, der vom Ende der Geschichte kündete. In einer Klitterung der
Hegelschen Geschichtsphilosophie prognostizierte Francis Fukuyama den endgültigen
Siegeszug des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus. Mit der finalen Durchsetzung
von Marktwirtschaft und Demokratie sei die Geschichte in ihrem höchsten Stadium an- und
damit zu sich gekommen, behauptete Fukuyama.
Drei Dekaden später wissen wir, dass sich der Kapitalismus zwar in unterschiedlichen
Varianten global ausgebreitet hat, die Demokratie aber seit 15 Jahren weltweit stagniert,
wenn nicht regrediert.
Als nationale, politische Steuerung noch möglich war
Wenn es je ein goldenes Zeitalter der Koexistenz und Symmetrie von Kapitalismus und
Demokratie gegeben hat, dann war es die Phase von 1950 bis in die Mitte der Siebzigerjahre.
Der Kapitalismus, in Deutschland sprach man von der sozialen Marktwirtschaft, war
gezähmt durch politisch gewollte Marktregulierungen und einen interventionistisch-
keynesianischen Wohlfahrtsstaat. Dies galt für Nord- und Westeuropa mehr als für die USA.
Aber selbst dort hatten sich Formen der neoklassisch-keynesianischen Synthese (Joan
Robinson prägte den Begriff des Bastardkeynesianismus) etabliert. Kombiniert mit dem
sozialpolitischen Reformprogramm namens Great Society des US-Präsidenten Lyndon B.
Johnson wurde der Kapitalismus auch in den USA sozialen und politischen Verpflichtungen
unterworfen.
Diese Entscheidungen waren politisch, sie waren demokratiegetrieben, nicht
marktgetrieben. Die Nachkriegsperiode war geprägt vom Ausbau des Sozialstaats, von
Regulierungen auf dem Arbeits- und Finanzmarkt. In der Folge verringerte sich die
Ungleichheit der Einkommen. Die Volkswirtschaft war in mancher Hinsicht noch eine
Nationalökonomie, die politischer Steuerung zugänglich war – und nicht den raschen
Abfluss von Investitionskapital fürchten musste. Die Ära des national koordinierten
Nachkriegskapitalismus ging dann in den Währungsturbulenzen zu Beginn der
Siebzigerjahre, der Ölpreiskrise und der nachfolgenden Stagflation zu Ende.
Aus dem demokratischen Zugriff entlassen
Die goldene Ära des Kapitalismus begann mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan Anfang
der Achtzigerjahre. Mit ihrer Politik begann die neoliberale Globalisierung. In den folgenden
vier Jahrzehnten hat der Kapitalismus dann eine doppelte Entgrenzung erfahren: Er wurde
wahrlich global. Und er wurde aufgrund politischer Entscheidungen von den sozialen und
politischen Zumutungen befreit – durch Deregulierung und Entstaatlichung.
Dies führte zu dem Paradox, dass die Demokratie mit demokratisch getroffenen
Entscheidungen die Ökonomie weitgehend aus ihrem zukünftigen demokratischen Zugriff
entließ. Das gilt zumindest für die westlichen Marktwirtschaften. Anders gelagert war der
autoritäre Bastardkapitalismus Chinas und Vietnams, der protoliberales Manchestertum mit
etatistisch-merkantilistischer Außenwirtschaftskontrolle verbindet.
Im Westen vollzog sich der Übergang vom gesteuerten Industriekapitalismus zu einer neuen
Form des Finanzkapitalismus, der in der Debatte häufig als Finanzialisierung bezeichnet
wird. Der grenzüberschreitende Kapitalverkehr schwoll gewaltig an und ein großer Teil
davon diente nicht der Investition in produktive Zwecke, sondern wurde für
Finanzspekulationen verwendet. Es entstanden große Profite, denen häufig keine
Wertschöpfung mehr entgegenstand. Der Shareholder Value avancierte zum alleinigen
Maßstab.
"Das Finanzkapital ist auf den Fahrersitz gesetzt worden", zitiert der Historiker Jürgen
Kocka George Soros, der zeitweise selbst ein bedeutender Akteur im Kasinokapitalismus war.
Drei Thesen
Welche Auswirkungen hatte die neue Form des Finanzkapitalismus auf die Demokratie?
1. Die sozioökonomische Ungleichheit hat sich verstärkt
Das betrifft Einkommen, Vermögen und Bildung. Die unteren Bildungsschichten sind in
vielen Demokratien aus der politischen Partizipation ausgestiegen. Dies gilt selbst für die
kognitiv anspruchsloseste politische Beteiligungsform, nämlich Wahlen. In den USA haben
2012 bei den Präsidentschaftswahlen 80 Prozent derjenigen Personen angegeben, zur Wahl
zu gehen, die über ein Haushaltseinkommen von 100.000 US-Dollar und mehr verfügten;
von jenen Bürgern aber, die ein Einkommen von 15.000 Dollar und weniger hatten, erklärte
nur ein Drittel seine Wahlabsicht.
Auch in Deutschland ist das untere Drittel aus der Partizipation ausgestiegen. Deutschland
ist zu einer zwar stabilen, aber dafür sozial selektiven Zweidritteldemokratie geworden.
Sozioökonomische Ungleichheit übersetzt sich in kapitalistischen Demokratien sehr direkt in
die Ungleichheit politischer Beteiligung.
2. Der Staat ist verwundbarer geworden
Banken, Hedgefonds und Großinvestoren diktieren direkt oder indirekt den Regierungen,
wie sie besteuert werden wollen. Amazon in den USA und Google in Irland sind hier nur die
spektakulärsten Fälle. Folgen die Regierungen nicht den Steuerbefreiungsforderungen der
Investoren, wandern diese in Niedrigsteuerländer ab. Politiker wollen gewählt oder
wiedergewählt werden. Fehlende Investitionen aber gefährden Konjunktur, Wachstum und
Arbeitsplätze – und damit ihre Wiederwahl. Das Erpressungspotenzial geografisch flexiblen
Anlagekapitals gegenüber demokratisch gewählten Regierungen hat zugenommen. Wie
unter einem Brennglas hat sich dies in der Finanzkrise von 2007/2008 vor allem in Europa
gezeigt. Die Banken erwiesen sich als too big to fail.Da der Staat die desaströsen
Dominoeffekte kollabierender Banken befürchtete, rettete er viele von ihnen mit dem
Steuergeld der Bürger.
3. Finanzkapitalismus und Globalisierung begünstigen die Entparlamentarisierung
In Zeiten der Globalisierung weist der Finanzkapitalismus einige Besonderheiten auf:
Digitalisierung, Geschwindigkeit, Volumen, Komplexität und die räumliche Entgrenzung
und Reichweite finanzieller Transaktionen. Parlamente dagegen, der institutionelle Kern der
Demokratie, sind territorial begrenzt und benötigen Zeit für die Vorbereitung, Beratung und
Verabschiedung von Gesetzen. So ist die Desynchronisierung von Politik und Finanzmärkten
systemisch bedingt und unvermeidbar.
Dieses neue empire of speed begünstigt innerhalb der Politik jene politischen Verfahren, die
nicht deliberativ und zeitkonsumierend sind, sondern dezisionistisch. Begünstigt wird also
tendenziell die Exekutive, die häufig kurzfristiger agieren kann. Auch die Expertise in
komplizierten Finanzfragen ist stärker in der exekutiven Administration vorhanden als bei
den Durchschnittsparlamentariern oder ihren Fraktionen. Wenn sich dann die Exekutiven
mehrerer Staaten finanzpolitisch koordinieren, können die Parlamente eigentlich nur noch
zusehen.
Allerdings profitiert die Exekutive nur teilweise von der politischen Machtverschiebung, da
ein Teil ihrer Kompetenzen in Zentralbanken, Expertenzirkel, Finanzkanzleien und zu
anderen Finanzakteuren abgewandert ist. Die Machtverschiebung erfolgt also von der
Legislative auf die Exekutive – und von dort auf private oder supranationale Finanzakteure.
Was ist zu tun?
Gesucht wird heute eine neue Balance, die die normative Superiorität der Demokratie, also
der Volkssouveränität, neu festschreibt. Die Ungleichheitsverwerfungen des Kapitalismus
müssen so moderiert werden, dass das demokratische Gebot der politischen Gleichheit nicht
suspendiert wird – und gleichzeitig die Kraft der schöpferischen Zerstörung in
wirtschaftliche Produktivität nicht gebrochen wird.
Erst wenn die demokratischen Fundamente von Gleichheit und Freiheit nicht mehr durch
entfesselte Märkte unterspült werden, lässt sich der Kapitalismus mit den Grundprinzipien
der Demokratie versöhnen.



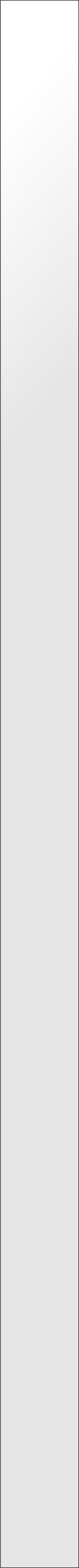
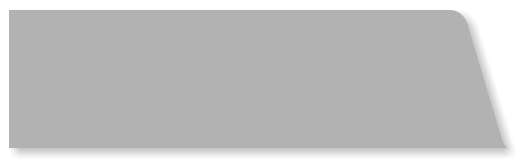
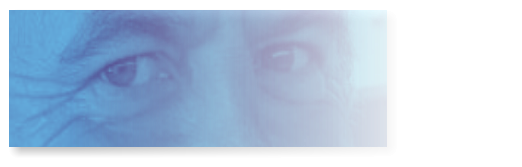


Kapitalismus: Aus dem Gleichgewicht
"Das Finanzkapital ist auf den Fahrersitz
gesetzt worden" (George Soros 1998) ©
Bobby Yip/Reuters
Aus dem Gleichgewicht
Wolfgang Merkel ist Direktor der
Forschungsabteilung Demokratie
und Demokratisierung am
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) und
Professor für Politikwissenschaft an
der Humboldt-Universität zu Berlin.
Kapitalismus und Demokratie sind
heute höher entwickelt denn je.
Gleichzeitig sind sie fragiler und
verwundbarer geworden. Die
Balance zwischen Politik und
Ökonomie ist aus dem Gleichgewicht
geraten. Ein Rückblick auf die
Entwicklung und drei Thesen sollen
verdeutlichen, wie es dazu kam.
Als 1989 die diktatorischen Regime
des Sowjetkommunismus zu kippen
begannen, schrieb ein noch
unbekannter Angestellter des State
Departments der Vereinigten
Staaten von Amerika einen Essay,
der vom Ende der Geschichte
kündete. In einer Klitterung der
Hegelschen Geschichtsphilosophie
prognostizierte Francis Fukuyama
den endgültigen Siegeszug des
wirtschaftlichen und politischen
Liberalismus. Mit der finalen
Durchsetzung von Marktwirtschaft
und Demokratie sei die Geschichte
in ihrem höchsten Stadium an- und
damit zu sich gekommen,
behauptete Fukuyama.
Drei Dekaden später wissen wir,
dass sich der Kapitalismus zwar in
unterschiedlichen Varianten global
ausgebreitet hat, die Demokratie
aber seit 15 Jahren weltweit
stagniert, wenn nicht regrediert.
Als nationale, politische Steuerung
noch möglich war
Wenn es je ein goldenes Zeitalter der
Koexistenz und Symmetrie von
Kapitalismus und Demokratie
gegeben hat, dann war es die Phase
von 1950 bis in die Mitte der
Siebzigerjahre. Der Kapitalismus, in
Deutschland sprach man von der
sozialen Marktwirtschaft, war
gezähmt durch politisch gewollte
Marktregulierungen und einen
interventionistisch-keynesianischen
Wohlfahrtsstaat. Dies galt für Nord-
und Westeuropa mehr als für die
USA. Aber selbst dort hatten sich
Formen der neoklassisch-
keynesianischen Synthese (Joan
Robinson prägte den Begriff des
Bastardkeynesianismus) etabliert.
Kombiniert mit dem
sozialpolitischen Reformprogramm
namens Great Society des US-
Präsidenten Lyndon B. Johnson
wurde der Kapitalismus auch in den
USA sozialen und politischen
Verpflichtungen unterworfen.
Diese Entscheidungen waren
politisch, sie waren
demokratiegetrieben, nicht
marktgetrieben. Die
Nachkriegsperiode war geprägt vom
Ausbau des Sozialstaats, von
Regulierungen auf dem Arbeits- und
Finanzmarkt. In der Folge
verringerte sich die Ungleichheit der
Einkommen. Die Volkswirtschaft
war in mancher Hinsicht noch eine
Nationalökonomie, die politischer
Steuerung zugänglich war – und
nicht den raschen Abfluss von
Investitionskapital fürchten musste.
Die Ära des national koordinierten
Nachkriegskapitalismus ging dann
in den Währungsturbulenzen zu
Beginn der Siebzigerjahre, der
Ölpreiskrise und der nachfolgenden
Stagflation zu Ende.
Aus dem demokratischen Zugriff
entlassen
Die goldene Ära des Kapitalismus
begann mit Margaret Thatcher und
Ronald Reagan Anfang der
Achtzigerjahre. Mit ihrer Politik
begann die neoliberale
Globalisierung. In den folgenden
vier Jahrzehnten hat der
Kapitalismus dann eine doppelte
Entgrenzung erfahren: Er wurde
wahrlich global. Und er wurde
aufgrund politischer
Entscheidungen von den sozialen
und politischen Zumutungen befreit
– durch Deregulierung und
Entstaatlichung.
Dies führte zu dem Paradox, dass die
Demokratie mit demokratisch
getroffenen Entscheidungen die
Ökonomie weitgehend aus ihrem
zukünftigen demokratischen Zugriff
entließ. Das gilt zumindest für die
westlichen Marktwirtschaften.
Anders gelagert war der autoritäre
Bastardkapitalismus Chinas und
Vietnams, der protoliberales
Manchestertum mit etatistisch-
merkantilistischer
Außenwirtschaftskontrolle
verbindet.
Im Westen vollzog sich der
Übergang vom gesteuerten
Industriekapitalismus zu einer
neuen Form des Finanzkapitalismus,
der in der Debatte häufig als
Finanzialisierung bezeichnet wird.
Der grenzüberschreitende
Kapitalverkehr schwoll gewaltig an
und ein großer Teil davon diente
nicht der Investition in produktive
Zwecke, sondern wurde für
Finanzspekulationen verwendet. Es
entstanden große Profite, denen
häufig keine Wertschöpfung mehr
entgegenstand. Der Shareholder
Value avancierte zum alleinigen
Maßstab.
"Das Finanzkapital ist auf den
Fahrersitz gesetzt worden", zitiert
der Historiker Jürgen Kocka George
Soros, der zeitweise selbst ein
bedeutender Akteur im
Kasinokapitalismus war.
Drei Thesen
Welche Auswirkungen hatte die neue
Form des Finanzkapitalismus auf die
Demokratie?
1. Die sozioökonomische Ungleichheit
hat sich verstärkt
Das betrifft Einkommen, Vermögen
und Bildung. Die unteren
Bildungsschichten sind in vielen
Demokratien aus der politischen
Partizipation ausgestiegen. Dies gilt
selbst für die kognitiv
anspruchsloseste politische
Beteiligungsform, nämlich Wahlen.
In den USA haben 2012 bei den
Präsidentschaftswahlen 80 Prozent
derjenigen Personen angegeben, zur
Wahl zu gehen, die über ein
Haushaltseinkommen von 100.000
US-Dollar und mehr verfügten; von
jenen Bürgern aber, die ein
Einkommen von 15.000 Dollar und
weniger hatten, erklärte nur ein
Drittel seine Wahlabsicht.
Auch in Deutschland ist das untere
Drittel aus der Partizipation
ausgestiegen. Deutschland ist zu
einer zwar stabilen, aber dafür sozial
selektiven Zweidritteldemokratie
geworden. Sozioökonomische
Ungleichheit übersetzt sich in
kapitalistischen Demokratien sehr
direkt in die Ungleichheit politischer
Beteiligung.
2. Der Staat ist verwundbarer
geworden
Banken, Hedgefonds und
Großinvestoren diktieren direkt oder
indirekt den Regierungen, wie sie
besteuert werden wollen. Amazon in
den USA und Google in Irland sind
hier nur die spektakulärsten Fälle.
Folgen die Regierungen nicht den
Steuerbefreiungsforderungen der
Investoren, wandern diese in
Niedrigsteuerländer ab. Politiker
wollen gewählt oder wiedergewählt
werden. Fehlende Investitionen aber
gefährden Konjunktur, Wachstum
und Arbeitsplätze – und damit ihre
Wiederwahl. Das
Erpressungspotenzial geografisch
flexiblen Anlagekapitals gegenüber
demokratisch gewählten
Regierungen hat zugenommen. Wie
unter einem Brennglas hat sich dies
in der Finanzkrise von 2007/2008
vor allem in Europa gezeigt. Die
Banken erwiesen sich als too big to
fail.Da der Staat die desaströsen
Dominoeffekte kollabierender
Banken befürchtete, rettete er viele
von ihnen mit dem Steuergeld der
Bürger.
3. Finanzkapitalismus und
Globalisierung begünstigen die
Entparlamentarisierung
In Zeiten der Globalisierung weist
der Finanzkapitalismus einige
Besonderheiten auf: Digitalisierung,
Geschwindigkeit, Volumen,
Komplexität und die räumliche
Entgrenzung und Reichweite
finanzieller Transaktionen.
Parlamente dagegen, der
institutionelle Kern der Demokratie,
sind territorial begrenzt und
benötigen Zeit für die Vorbereitung,
Beratung und Verabschiedung von
Gesetzen. So ist die
Desynchronisierung von Politik und
Finanzmärkten systemisch bedingt
und unvermeidbar.
Dieses neue empire of speed
begünstigt innerhalb der Politik jene
politischen Verfahren, die nicht
deliberativ und zeitkonsumierend
sind, sondern dezisionistisch.
Begünstigt wird also tendenziell die
Exekutive, die häufig kurzfristiger
agieren kann. Auch die Expertise in
komplizierten Finanzfragen ist
stärker in der exekutiven
Administration vorhanden als bei
den Durchschnittsparlamentariern
oder ihren Fraktionen. Wenn sich
dann die Exekutiven mehrerer
Staaten finanzpolitisch koordinieren,
können die Parlamente eigentlich
nur noch zusehen.
Allerdings profitiert die Exekutive
nur teilweise von der politischen
Machtverschiebung, da ein Teil ihrer
Kompetenzen in Zentralbanken,
Expertenzirkel, Finanzkanzleien und
zu anderen Finanzakteuren
abgewandert ist. Die
Machtverschiebung erfolgt also von
der Legislative auf die Exekutive –
und von dort auf private oder
supranationale Finanzakteure.
Was ist zu tun?
Gesucht wird heute eine neue
Balance, die die normative
Superiorität der Demokratie, also
der Volkssouveränität, neu
festschreibt. Die
Ungleichheitsverwerfungen des
Kapitalismus müssen so moderiert
werden, dass das demokratische
Gebot der politischen Gleichheit
nicht suspendiert wird – und
gleichzeitig die Kraft der
schöpferischen Zerstörung in
wirtschaftliche Produktivität nicht
gebrochen wird.
Erst wenn die demokratischen
Fundamente von Gleichheit und
Freiheit nicht mehr durch entfesselte
Märkte unterspült werden, lässt sich
der Kapitalismus mit den
Grundprinzipien der Demokratie
versöhnen.