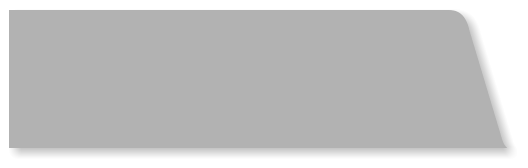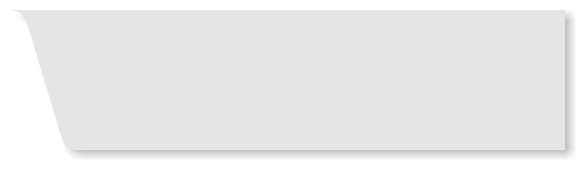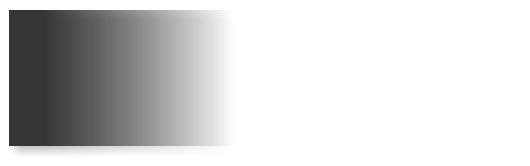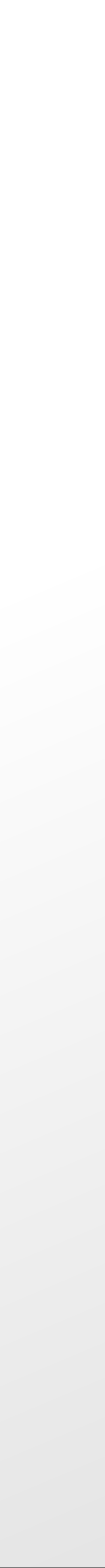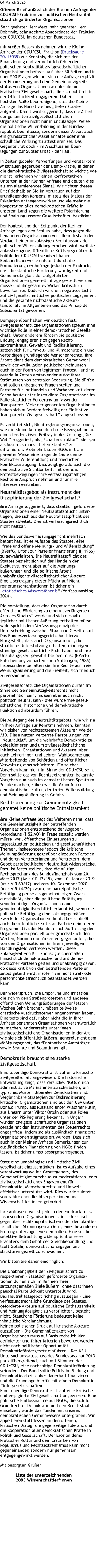Siegfried
Trapp
Willkommen
Bienvenido
Welcome



Foto: Liesa
Johannssen/reuters

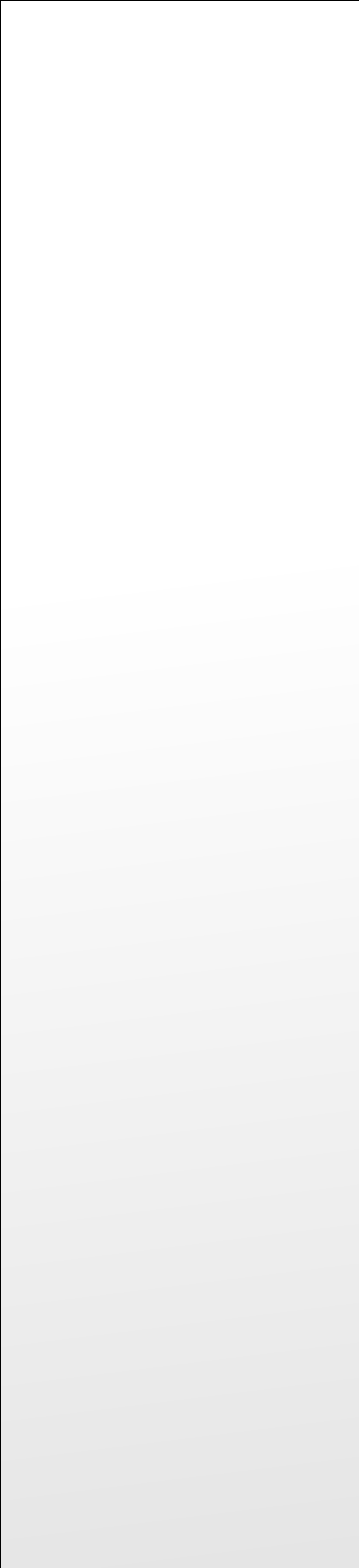

04 March 2025
Offener Brief anlässlich der Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur
politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen
Sehr geehrter Herr Merz, sehr geehrter Herr Dobrindt, sehr geehrte Abgeordnete der Fraktion der
CDU/CSU im deutschen Bundestag,
mit großer Besorgnis nehmen wir die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (Drucksache 20/15035)
zur Kenntnis, die sich mit der Finanzierung und vermeintlich fehlenden politischen Neutralität
zivilgesellschaftlicher Organisationen befasst. Auf über 30 Seiten und in über 500 Fragen widmet
sich die Anfrage explizit der Finanzierung und dem Gemeinnützigkeitsstatus von Organisationen
aus der demokratischen Zivilgesellschaft, die sich politisch in der Öffentlichkeit engagieren. Dabei
ist im höchsten Maße beunruhigend, dass die Kleine Anfrage das Narrativ eines „tiefen Staates“
aufgreift. Damit wird suggeriert, dass die Arbeit der genannten zivilgesellschaftlichen
Organisationen nicht nur in unzulässiger Weise die politische Willensbildung in der Bundesrepublik
beeinflusse, sondern dieser Arbeit auch ein grundsätzlicher Makel anhafte oder eine schädliche
Wirkung zu attestieren sei. Das Gegenteil ist doch – im Anschluss an Überlegungen zur Subsidiarität
– der Fall.
In Zeiten globaler Verwerfungen und verstärktem Misstrauen gegenüber der Demokratie, in denen
die demokratische Zivilgesellschaft so wichtig wie nie ist, erkennen wir einen konfrontativen
Unterton in der Kleinen Anfrage und deuten dies als ein alarmierendes Signal. Wir richten diesen
Brief deshalb an Sie im Vertrauen auf den grundlegenden Konsens, mittels des Dialogs der
Eskalation entgegenzuwirken und vielmehr die Kooperation aller demokratischen Kräfte in
unserem Land gegen die weitere Polarisierung und Spaltung unserer Gesellschaft zu bestärken.
Der Kontext und der Zeitpunkt der Kleinen Anfrage legen den Schluss nahe, dass gegen die
benannten Organisationen vor allem deshalb der Verdacht einer unzulässigen Beeinflussung der
politischen Willensbildung erhoben wird, weil sie anlassbezogene, öffentliche Kritik gegenüber der
Politik der CDU/CSU geäußert haben. Bedauerlicherweise entsteht durch die Formulierung der
Anfrage jedoch der Eindruck, dass die staatliche Förderungswürdigkeit und Gemeinnützigkeit der
aufgeführten Organisationen generell infrage gestellt werden müsse und ihr gesamtes Wirken
kritisch zu bewerten sei. Dadurch wird ein negatives Licht auf zivilgesellschaftliches politisches
Engagement und die gesamte nichtstaatliche Akteurslandschaft im Allgemeinen und das Prinzip der
Subsidiarität geworfen.
Demgegenüber halten wir deutlich fest: Zivilgesellschaftliche Organisationen spielen eine wichtige
Rolle in einer demokratischen Gesellschaft. Unter anderem fördern sie politische Bildung,
engagieren sich gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Radikalisierung, setzen sich für Umwelt-
und Klimaschutz ein und verteidigen grundlegende Menschenrechte. Ihre Arbeit dient dem
demokratischen Gemeinwohl sowie der Artikulation politischer Meinungen – auch in der Form von
legitimem Protest – und ist gerade in Zeiten erstarkender autoritärer Strömungen von zentraler
Bedeutung. Sie dürfen und sollen unbequeme Fragen stellen und Parteien für ihr Handeln und
Vorhaben kritisieren. Schon heute unterliegen diese Organisationen im Falle staatlicher Förderung
umfassender Transparenz. Viele der genannten Organisationen haben sich außerdem freiwillig der
“Initiative Transparente Zivilgesellschaft” angeschlossen.
Es verbittet sich, Nichtregierungsorganisationen, wie die Kleine Anfrage durch die Bezugnahme auf
einen tendenziösen Beitrag in der Zeitung „Die Welt“ suggeriert, als „Schattenstruktur“ oder gar
als Ausdruck eines „tiefen Staates“ zu diffamieren. Vielmehr bilden NGOs in transparenter Weise
eine tragende Säule demokratischer Willensbildung und friedlicher Konfliktaustragung. Dies zeigt
gerade auch die demonstrative Sichtbarkeit, mit der u.a. Protestbewegungen ihre
verfassungsmäßigen Rechte in Anspruch nehmen und für ihre Interessen eintreten.
Neutralitätsgebot als Instrument der Disziplinierung der Zivilgesellschaft?
Ihre Anfrage suggeriert, dass staatlich geförderte Organisationen einer Neutralitätspflicht unter-
liegen, die sich aus der Neutralitätspflicht des Staates ableitet. Dies ist verfassungsrechtlich nicht
haltbar.
Wie das Bundesverfassungsgericht mehrfach betont hat, ist es Aufgabe des Staates, eine „freie und
offene Meinungs- und Willensbildung“ (BVerfG, Urteil zur Parteienfinanzierung II, 1966) zu gewähr-
leisten. Die Neutralitätspflicht des Staates bezieht sich auf das Handeln der Exekutive, nicht aber
auf die Meinungsäußerungen und die politische Arbeit unabhängiger zivilgesellschaftlicher Akteure.
Eine Übertragung dieser Pflicht auf Nichtregierungsorganisationen ist daher ein „etatistisches
Missverständnis“ (Verfassungsblog 2024).
Die Vorstellung, dass eine Organisation durch öffentliche Förderung zu einem „verlängerten Arm
des Staates“ werde und sich deshalb jeglicher politischer Äußerung enthalten müsse, widerspricht
dem Verfassungsprinzip der Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Das Bundes-
verfassungsgericht hat hierzu klargestellt, dass auch Organisationen, die staatliche Unterstützung
erhalten, eine eigenständige gesellschaftliche Rolle haben und ihre Unabhängigkeit gewahrt
bleiben muss (BVerfG, Entscheidung zu parteinahen Stiftungen, 1986). Insbesondere behalten sie
ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung und die Freiheit, sich friedlich zu versammeln.
Zivilgesellschaftliche Organisationen dürfen im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts nicht partei-
ähnlich sein, müssen aber auch nicht politisch neutral sein – dies würde ihre gesellschaftliche,
historische und demokratische Funktion ad absurdum führen.
Die Auslegung des Neutralitätsgebots, wie wir sie in Ihrer Anfrage zur Kenntnis nehmen, kannten
wir bisher von rechtsextremen Akteuren wie der AfD. Diese nutzen verzerrte Darstellungen von
„Neutralität“, um die wehrhafte Demokratie zu delegitimieren und um zivilgesellschaftliche
Initiativen, Organisationen und Akteure, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, Wahlbeamte und
Mitarbeitende von Behörden und öffentlicher Verwaltung einzuschüchtern. Ein solches Vorgehen
kann nicht im Sinne der CDU/CSU sein. Denn sollte das von Rechtsextremisten bekannte Vorgehen
nun auch im demokratischen Spektrum Schule machen, sähen wir die Grundfesten demokratischer
Kultur, der freien Willensbildung und Meinungsäußerung in Gefahr.
Rechtsprechung zur Gemeinnützigkeit gebietet keine politische
Enthaltsamkeit
Ihre Kleine Anfrage legt des Weiteren nahe, dass die Gemeinnützigkeit der betreffenden
Organisationen entsprechend der Abgabenverordnung (§ 52 AO) in Frage gestellt werden müsse,
weil öffentliche Einlassungen zu tagesaktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen,
insbesondere jedoch die kritische Meinungsäußerung gegenüber einzelnen Parteien und deren
Vertreterinnen und Vertretern, dem Gebot parteipolitischer Neutralität widerspräche. Dazu ist
festzustellen, dass die gültige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 20. März 2017 (Az.: X R
13/15), vom 10. Januar 2019 (Az.: V R 60/17) und vom 10. Dezember 2020 (Az.: V R 14/20) zwar
eine parteipolitische Betätigung per se als gemeinnützigen Zweck ausschließt, aber die politische
Betätigung gemeinnützigen Organisationen dann gemeinnützigkeitsrechtlich erlaubt ist, wenn die
politische Betätigung dem satzungsgemäßen Zweck der Organisationen dient. Dies schließt auch
die öffentliche Kritik an Parteien ein, deren Programmatik oder Handeln nach Auffassung der
Organisationen partiell oder grundsätzlich den Werten, Normen und Zielen entgegenlaufen, die
von den Organisationen in ihrem jeweiligen Handlungsfeld vertreten werden. Diese Zulässigkeit
von Kritik muss gleichermaßen hinsichtlich demokratischer und antidemokratischer Parteien gelten
und unabhängig davon, ob diese Kritik von den betreffenden Parteien selbst geteilt wird, insofern
sie nicht straf- oder persönlichkeitsrechtlich beanstandet werden kann.
Der Widerspruch, die Empörung und Irritation, die sich in den Straßenprotesten und anderen
öffentlichen Meinungsäußerungen der letzten Wochen Bahn brachen, mögen teilweise drastische
Ausdrucksformen angenommen haben. Einerseits sind dafür aber nicht die in Ihrer Anfrage
benannten Organisationen verantwortlich zu machen. Andererseits unterliegen zivilgesellschaft-
liche Organisationen in der Art, wie sie sich öffentlich äußern, generell nicht dem Mäßigungsgebot,
das für staatliche Amtsträger sowie Beamte und Beamtinnen gilt.
Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft
Eine lebendige Demokratie ist auf eine kritische Zivilgesellschaft angewiesen. Die historische
Entwicklung zeigt, dass Versuche, NGOs durch administrative Maßnahmen zu schwächen, ein
typisches Muster illiberaler Demokratien sind. Vergleichbare Strategien zur Diskreditierung
kritischer Organisationen sind aus den USA unter Donald Trump, aus Russland unter Wladimir Putin,
aus Ungarn unter Viktor Orbán oder aus Polen unter der PiS-Regierung bekannt. In Ungarn wurden
zivilgesellschaftliche Organisationen gerade mit den Instrumenten des Steuerrechts angegriffen,
indem sie als ausländisch finanzierte Organisationen stigmatisiert wurden. Dass sich auch in der
kleinen Anfrage Bemerkungen zur ausländischen Finanzierung von NGOs finden lassen, ist daher
umso besorgniserregender.
Statt eine unabhängige und kritische Zivilgesellschaft einzuschränken, ist es Aufgabe eines
verantwortungsvollen Gesetzgebers, das Gemeinnützigkeitsrecht so zu modernisieren, dass
zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt effektiver
unterstützt wird. Dies wurde zuletzt von zahlreichen Rechtsexpert:innen und
Wissenschaftler:innen gefordert.
Ihre Anfrage erweckt jedoch den Eindruck, dass insbesondere Organisationen, die sich kritisch
gegenüber rechtspopulistischen oder demokratiefeindlichen Strömungen äußern, einer besonderen
Prüfung unterzogen werden sollen. Eine solche selektive Betrachtung widerspricht unseres
Erachtens dem Gebot der Gleichbehandlung und läuft Gefahr, demokratische
Engagementstrukturen gezielt zu schwächen.
Wir bitten Sie daher eindringlich:
Die Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft zu respektieren – Staatlich geförderte Organisationen
dürfen sich im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Ziele äußern, ohne dass ihnen pauschal
Parteilichkeit unterstellt wird.
Das Neutralitätsgebot richtig auszulegen – Eine verfassungsrechtliche Grundlage des Staates,
geförderte Akteure auf politische Enthaltsamkeit und Meinungslosigkeit zu verpflichten, besteht
nicht. Staatliche Förderung bedeutet keine inhaltliche Vereinnahmung.
Keinen politischen Druck auf kritische Akteure auszuüben – Die Gemeinnützigkeit von
Organisationen muss auf Basis rechtlich klar definierter und fairer Kriterien bewertet werden,
nicht nach politischer Opportunität.
Demokratiefördergesetz einführen – Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat 2013
parteiübergreifend, auch mit Stimmen der CDU/CSU, eine nachhaltige Demokratieförderung
gefordert. Der Bund sollte Politische Bildung und Demokratiearbeit daher dauerhaft finanzieren
und die Grundlage hierfür mit einem Demokratiefördergesetz schaffen.
Eine lebendige Demokratie ist auf eine kritische und engagierte Zivilgesellschaft angewiesen. Eine
politische Einflussnahme auf NGOs, die sich für Grundrechte, Demokratie und den Rechtsstaat
einsetzen, würde das Fundament unseres demokratischen Gemeinwesens untergraben. Wir
appellieren stattdessen an den offenen, kritischen Dialog, die gegenseitige Toleranz und die
Kooperation aller demokratischen Kräfte in Politik und Gesellschaft. Der Erosion demokratischer
Kultur und dem Erstarken von Populismus und Rechtsextremismus kann nicht gegeneinander,
sondern nur gemeinsam entgegengewirkt werden.
Mit besorgten Grüßen
Liste der unterzeichnenden 2083 Wissenschaftler*innen